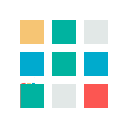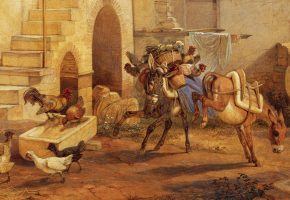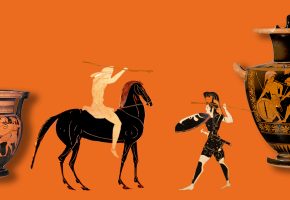Author: Annekathrin Braun
- all
- 16. Jahrhundert
- 17. Jahrhundert
- 18. Jahrhundert
- 19. Jahrhundert
- 20. Jahrhundert
- 21. Jahrhundert
- Alte Pinakothek
- Antike
- Archäologische Staatssammlung München
- Architekturmuseum der TUM
- Ausprobieren
- Barock
- Barrierearm
- Bauernmuseum Bamberger Land
- Bayerische Schlösserverwaltung
- Bayerische Staatsgemäldesammlung
- Bayerisches Armeemuseum
- Bayerisches Nationalmuseum
- Biedermeier
- Biologie
- Botanischer Garten München-Nymphenburg
- Burg Trausnitz
- DaZ
- Deutsch
- Deutsche Nationalbibliothek
- Deutsches Meeresmuseum
- Deutsches Museum
- Deutsches Theatermuseum
- Die Neue Sammlung – The Design Museum
- Domberg Bamberg
- Entdecken
- Erika Fuchs Haus
- Ernährung (und Gesundheit RS/und Soziales MS)
- Erwachsene
- Ethik
- Expressionismus
- Fächer
- Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim
- Fränkisches Freilandmuseum Fladungen
- Freilandmuseum Oberpfalz
- Freilichtmuseum Glentleiten
- Gegenwart
- Geographie
- Geschichte
- Gotik
- Grundschulkinder
- Haus der Kunst
- Heimat- und Sachunterricht (GS)
- Impressionismus
- Informatik und digitales Gestalten (MS)
- Jahrhundert / Epoche / Stil
- Jüdisches Museum Franken
- Jugendliche
- Jugendstil
- Konzeptkunst
- Kunst
- Kunst Spiele
- Latein
- Lehrkräfte
- Lenbachhaus
- Lieblingsmuseum
- Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee
- Martin von Wagner Museum
- Menschen mit besonderen Bedürfnissen
- Mittelalter
- Monacensia im Hildebrandhaus
- Münchner Residenz
- Münchner Stadtmuseum
- Museum Brandhorst
- Museum Fünf Kontinente
- Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke
- Musik
- Natur und Technik
- Neue Pinakothek
- Neues Schloss Bayreuth
- Pädagogisches Fachpersonal
- Pinakothek der Moderne
- Politik und Gesellschaft
- politische Bildung
- Pop Art
- Postimpressionismus
- Realismus
- Religion
- Renaissance
- Rokoko
- Romantik
- Römer Museum
- Sammlung Schack
- Schloss Lustheim
- Schloss Neuburg an der Donau
- Schloss Nymphenburg
- Schlossmuseum Aschaffenburg
- Schlossmuseum Murnau
- Spätbarock
- Sport
- Staatliche Antikensammlung und Glyptothek
- Staatliche Münzsammlung
- Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg
- Stadtmuseum Abensberg
- Valentin-Karlstadt-Musäum
- Villa Stuck
- Vorschulkinder
- Wegbereiter der Moderne
- Werken und Gestalten
- Zeitgeschichte
- Zielgruppe
Was hat Kunst mit Natur zu tun? In unserer Osterferien-Aktion erfährst du digital allerhand über Blüten, Blättern und Ranken in den Münchner Museen. Wir stellen euch Schätze aus vier Museen vor, schauen uns Pflanzen ganz genau an, enträtseln Gemaltes und kunstvoll Gestaltetes. Es gibt Anregungen zum Beobachten, Zeichnen, Entwerfen, Malen, Kleben etc. Und so entstehen auch gleich neue Seiten für dein ganz persönliches MPZ-Album. Folgt uns auf Facebook oder Instagram! Dort werden wir auch alle neuen Aktionen verlinken. Wenn ihr uns eure Kunstwerke zeigen wollt, verwendet den Hashtag #MPZblätter. VON TULPEN, LILIEN UND GRASHÜPFERN OBSTBLÜTEN IM MUSEUM FRÜHLING IM BOTANISCHEN GARTEN TAPETE VERSCHLISSEN - ANSTRICH ERWÜNSCHT? Abbildungsnachweis von links nach rechts: 1) Peter Paul Rubens mit Jan Brueghel d. Ä., Madonna im Blumenkranz, um 1616/1618, Eichenholz, 185 x 209,8 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0; 2) Tischlampe „Apple Blossom“, Ausführung: Tiffany Studios New York, um 1902-1906. © Bayerisches Nationalmuseum München, Bearbeitet: Museumspädagogisches Zentrum; 3)Blütenfelder. © Botanischer Garten München-Nymphenburg; 4) Residenz München, Salon der Königin Therese. © Bayerische Schlösserverwaltung Abbildungsnachweis Titelbild: siehe Bildnachweis Beitrag. © Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum
Museen sammeln. Das ist zumindest eine der Aufgaben, die Museen haben. Dabei sind Museen oft spezialisiert – beispielsweise auf Gemälde oder Skulpturen, Gefäße der Antike oder archäologische Fundstücke, Maschinen, Spielzeug oder Fingerhüte, Fotografien, Tierknochen oder Steine und vieles andere mehr. Allein in Bayern gibt es über 1300 Museen! Und trotz der Verschiedenartigkeit der Kostbarkeiten, die in den einzelnen Museen gesammelt werden, finden sich manche Motive und Themen immer wieder. Und zwar in ganz unterschiedlichen Museen. Hühner gesucht! Sabine hat eine besondere Leidenschaft für Hühner – lebende Hühner. Immerhin zählen Hühner zu den häufigsten Haustieren! Deshalb haben wir uns in einigen Museen und deren Online-Sammlungen auf die Suche gemacht, ob auch dort wohl Sabines Lieblingstiere zu finden sind. Und wir haben jede Menge entdeckt! Hennen, Hähne, Küken …So finden sich Hühner auf zahllosen Gemälden, in ihren typischen Bewegungen und mit wunderbar schillerndem Gefieder gemalt. In manch einem Bild spielen sie die Hauptrolle, sie dienen zur Belebung einer ländlichen Szene oder tummeln sich an den Nebenschauplätzen in weihnachtlichen Krippen. Manchmal sind sie auch Teil eines Stilllebens, liegen hier – oft bereits gerupft – fertig zur Zubereitung in der Küche auf dem Tisch. Und schon fällt uns die Hühnerbraterei auf dem Oktoberfest ein. – Ein Foto davon aus dem Jahr 1921 gibt es im Münchner Stadtmuseum. Wenn du auf die Bilder klickst, vergrößern sie sich. In einer Ölskizze festgehalten Genial beobachtet und meisterhaft realistisch gemalt, lange bevor Fotos eine Hilfe hätten sein können Eine sogenannte „Kraienköppe“ – das ist eine besondere Hühnerrasse – ist auch dabei … mehr zu diesem Gemälde. Lebloses zum Stillleben angeordnet Unterm Tisch und auf dem Spieß … Zur Duftwolke des Münchner Oktoberfestes gehören Brathendl einfach dazu von links nach rechts: Hubert von Heyden, Henne mit zwei Küken (Studie), um 1897, Öl auf Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0; Melchior d' Hondecoeter, Hühnerhof, Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Sammlungsbestand Alte Pinakothek (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0; Jacob Jordaens, Der Satyr beim Bauern, um 1620/21, Leinwand auf Eichenholz aufgezogen, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0; Carl Schuch, Stillleben mit gerupftem Huhn, um 1885, Öl auf Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Sammlungsbestand Neue Pinakothek (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0; Rundkrippe mit Verkündigung an die Hirten, Anbetung und volkstümlichen Szenen (Ausschnitt), Neapel 2. Hälfte 18. Jahrhundert © Bayerisches Nationalmuseum München; Philipp Kester, Münchner Oktoberfest – Hühnerbraterei, 1921, Fotografie, Gelatineentwicklungspapier, Münchner Stadtmuseum, Sammlung Fotografie, Archiv Kester (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0 Ein gebratenes Hendl gibt es aber auch in dem Gemälde „Schlaraffenland“ aus dem 16. Jahrhundert von Pieter Bruegel d. Ä. zu sehen. Es hat die gleichnamige Geschichte von Hans Sachs zum Thema. Im Schlaraffenland, so heißt es hier, flögen gebratene Hühner herum und den Faulen sogar direkt in den Mund. – Bei Bruegel liegt allerdings das gebratene Huhn nur auf dem Tisch. Pieter Bruegel d. Ä., Das Schlaraffenland, 1567, Eichenholz, 51,5 x 78,3 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0 Krähen, picken, gackern ... Die alten Griechen waren vom Kampfverhalten der Hähne fasziniert, die ihre Rivalen aus dem Revier vertreiben. Deshalb sind Hahnenkämpfe sogar auf Vasen der Antike abgebildet. von links nach rechts: Vase mit Hahnenkampfszene, Bandschale des Tleson-Malers, Ton, 550-530 v. Chr., aus Athen, gefunden in Tarent. Staatliche Antikensammlungen, München Foto: © Renate Kühling, Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek; Ernst Andreas Rauch, Goldener Hahn (7), 1958, München, Borstei, Foto: © Museumspädagogisches Zentrum; Hühner im Freilichtmuseum, Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee © Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee; Hubert van Heyden, Geflügelhof, um 1900, Öl auf Leinwand, Bayerische Staatsgemäldesammlungen (nicht ausgestellt) CC BY-SA 4.0 Dass aber Hähne nicht nur kampflustig sind, sondern auch Frieden stiften können, zeigt sich in der Münchner Borstei: Dort steht auf einem Sockel ein goldener Hahn, der an Alexander Puschkins „Märchen vom goldenen Hahn“ erinnern könnte. Es handelt davon, dass Hühner vor nahenden Feinden warnen. Denn sie können über ihre Füße Schwingungen im Boden spüren. Richtig Leben bringen Hühner in manch ein Freilichtmuseum. Dort kannst du sie beobachten beim Gackern, Picken und Sandbaden. Aufgeregte Hühner © Museumspädagogisches Zentrum Denn seit den alten Römern gehörten Hühner über Jahrhunderte zu einem Garten dazu und trugen so zur Ernährung der Bevölkerung direkt vor Ort bei. Ei, Ei ... Zugegeben: Auf unserer Suche haben wir auch manchmal um die Ecke gedacht. Denn welche Rolle spielen denn Hühnereier für uns? Wir essen Eier hart- oder weichgekocht – im Schlaraffenland würden wir sie direkt aus der laufenden Schale löffeln –, wir braten Spiegeleier, backen mit Eiern Kuchen oder stellen damit Nudeln her. Durchschnittlich isst jede(r) Deutsche pro Jahr etwa 230 Eier! – Grund genug, einmal darauf zu achten, wo die Eier herkommen, wie die Hennen leben und wo sie für uns die Eier legen!Doch aus Ei lässt sich noch viel mehr herstellen. Farbe zum Beispiel. Wird Farbpigment mit Ei angerührt, erhält man sogenannte Tempera. Wie wunderbar diese zarten Farben auch noch nach fast 600 Jahren strahlen, kannst du in der Alten Pinakothek bewundern: Fra Filippo Lippi, Verkündigung Mariae, um 1443/45, Tempera auf Pappelholz, 205,8 x 187,9 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0 Aber auch in der Impfstoffherstellung spielt Hühnereiweiß eine wichtige Rolle. Wir sind sicher: Auch hierzu gibt es in einem Museum, das sich mit Medizingeschichte auseinandersetzt, ein passendes Exponat. Hühnergötter, Deutsches Meeresmuseum Stralsund, Foto: © Jan-Peter Reichert, Deutsches Meeresmuseum Und übrigens: Damit die Hühner im Stall gut geschützt sind und gut legen, wurden mancherorts „Hühnergötter“ aufgehängt. So werden Feuersteine genannt, bei denen im Meer Kalkeinschlüsse ausgewaschen wurden, so dass ein Loch entstand. Solche Steine findest du an Nord- und Ostsee oder zum Beispiel auch im Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Entwirf deine Hühner-Ausstellung im Modell! Stell dir vor, du planst – als Ausstellungs-Kurator*in – eine Sonderausstellung zum Thema Hühner. Überlege dir, welche Objekte aus welchen Museen du gerne ausstellen würdest. Welche Themen möchtest du in deiner Ausstellung behandeln, was den Besuchern mitteilen?Stöbere in Ausstellungskatalogen oder Online-Sammlungen verschiedener Museen, schau dich bei Museumsbesuchen, im Stadtraum oder in der Wohnung um. Was könnte zum Thema Hühner passen?Du brauchst:• Papier• Karton• Knetmasse oder Schokoeiereinwickelmetallfolie• Stifte, Schere, Klebeband• Schuhkarton(s), dein Puppenhaus, falls du dieses hierfür verwenden darfst, oder Ähnliches So geht’s:• Dein Puppenhaus oder der Schuhkarton dienen dir als Ausstellungsräume im Miniformat. Überlege, wie groß deine Exponate im Modell werden dürfen, damit sie in diese „Räume“ passen.• Fertige entsprechend kleine Zeichnungen von den Exponaten an, male Rahmen darum und schneide sie aus.• Forme dreidimensionale Exponate – Skulpturen zum Beispiel – als kleine Figuren aus Knetmasse. Bau einen kleinen Sockel aus Karton dazu.• Sortiere deine „Exponate“ nach Themen.• Nutze dein Puppenhaus oder einen Schuhkarton, um deine Ausstellung aufzubauen.• Probiere aus, ob an mancher Wand ein Hintergrund aus farbigem Papier gut wäre.• Jetzt brauchst du nur noch Publikum. Lade dazu Spielfiguren in deine Ausstellung ein! Ausstellungsaufbau im Schuhkarton. Mit Skizzen nach Pablo Picasso, Jacobus (Jacomo) Victors, Philipp Kester, Pieter Bruegel d. Ä. und Mario Sala, Bozetto nach Ernst Andreas Rauch © Museumspädagogisches Zentrum Noch mehr entdeckt? Noch viel mehr Exponate rund um das Thema Hühner sind in den verschiedensten Museen zu finden! In Kunstmuseen, Medizinhistorischen Sammlungen und, und, und … Teile deine Entdeckungen auf Facebook oder Instagram und verwende den Hashtag #MPZtierisch. Aber Vorsicht! Nicht alle Objekte in Museen dürfen einfach fotografiert werden! Mach also auch mal eine Skizze oder sende eine Textnachricht. TIPP: Genug über Hühner erfahren? Dann mach dich bei deinem nächsten Museumsbesuch mal auf die Suche nach deinem persönlichen Lieblingstier und lass dich anregen, so jede Menge Neues über dieses Tier herauszufinden! MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Vom Haustier bis zum Fabelwesen – Tierdarstellungen in der Kunst (GYM bis Jgst. 11, MS, RS) Passende MPZ-FührungGeflügelte Drachen, zahme Löwen oder die Kuh im "Wohnzimmer". Tiere auf Bildern in der Alten Pinakothek (Horte, MS bis Jgst. 6, RS bis Jgst. 6, GYM bis Jgst. 6, FöS, GS)Welche Krippe ist die schönste? – Die Krippensammlung des Bayerischen Nationalmuseums (Horte, GS) Informationen zum MuseumDie hier vorgestellten Hühner stammen aus diesen Museen: Alte Pinakothek, Bayerisches Nationalmuseum, Deutsches Meeresmuseum, Markus Wasmeier Freilichtmuseum Schliersee, Münchner Stadtmuseum, Staatliche Antikensammlungen, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau. Mit dem Museumsportal findest du Museen in deiner Nähe. Abbildungsnachweis Titelbild: Carl Wilhelm Freiherr von Heideck, Haus in Athen (Ausschnitt), 1838, Leinwand, 69 x 47 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München (nicht ausgestellt), URL: https://www.lenbachhaus.de/entdecken/sammlung-online/detail/haus-in-athen-30016533, CC BY-SA 4.0
Heute ist es ganz selbstverständlich: Frauen haben das gleiche Recht auf Bildung wie Männer! Dafür mussten Frauen aber lange kämpfen. Noch im 19. Jahrhundert galten Mädchen und Frauen als unbegabt für Mathematik oder Naturwissenschaften. Doch einige mutige Frauen arbeiteten damals schon als Forscherinnen und lieferten den Beweis, dass das nicht stimmt. Im 20. Jahrhundert – in Bayern 1903 – wurden Frauen dann gegen den Widerstand vieler Männer endlich zum Universitätsstudium zugelassen und eroberten die Hörsäle.Wer waren solche „starke“ Frauen? Namen wie Marie Curie und Lise Meitner sind halbwegs bekannt, aber wer hat schon von Caroline Herschel und Cecilia Payne gehört? – All diese Frauen waren hervorragende Wissenschaftlerinnen und haben bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Wir möchten euch jetzt einige von ihnen vorstellen, die es nicht, wie viele ihrer männlichen Kollegen, zu einem Denkmal in einer Ruhmeshalle gebracht haben. Caroline Herschel (1750 - 1848) Ölgemälde: Melchior Gommar Tieleman; Foto des gemeinfreien Gemäldes: unbekannt, 1829 Melchior Gommar Tieleman, Ölgemälde Caroline Herschel Hannover (Ausschnitt), als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons Lange bevor Frauen an die Universitäten durften, glänzte Caroline Herschel als erste weibliche Astronomin. Sie hatte das Glück, als Mädchen rechnen und schreiben lernen zu dürfen. Ihr Vater war ein großer Bewunderer der Astronomie und gab diese Begeisterung an seine Kinder weiter. Mit 22 Jahren folgte Caroline ihrem älteren Bruder Friedrich Wilhelm Herschel nach England. Dort arbeitete sie als Haushälterin für ihren Bruder, unterstützte ihn aber gleichzeitig auch bei der Himmelsforschung und beim Bau seiner Teleskope. Unbekannter Autor, Herschel 40 foot, als gemeinfrei gekennzeichnet, Details auf Wikimedia Commons Nachdem ihr Bruder Wilhelm durch die Entdeckung des Planeten Uranus im Jahr 1781 berühmt wurde, konnte sie ihm als wissenschaftliche Assistentin an den englischen Hof folgen. In den Nächten war sie mit ihrem Bruder auf Beobachtungsposten und notierte die Sternenorte, die er ihr vom oberen Ende seines riesigen Fernrohrs aus zurief. Caroline Herschel führte auch eigene astronomische Berechnungen durch. Nachdem sie 1786 einen Kometen entdeckt hatte, bekam sie am königlichen Hof eine Anstellung mit einem Gehalt von 50 Pfund im Jahr. Damit war sie die erste Frau, die als Wissenschaftlerin bezahlt wurde. Später entdeckte sie noch viele weitere Kometen sowie einige Doppelsterne und erstellte Kataloge für Sternenhaufen und Nebelflecken. Caroline Herschel wurde von den Gelehrten ihrer Zeit sehr geschätzt. Sogar ein Mondkrater und ein Kleinplanet wurden nach ihr benannt. Lise Meitner (1878 – 1968) Weiße Marmorbüste von Chrysille Schmitthenner, Lise Meitner, Atomphysikerin(1914-2000), im Ehrensaal des Deutschen Museums, 1991. © Deutsches Museum, Foto: BN47629 (Ausschnitt) Auch Lise Meitner gehörte noch zu den Frauen, die nicht das Gymnasium besuchen durften. Sie musste sich privat auf das Abitur vorbereiten. Nach ihrem Mathematik- und Physikstudium in Wien war sie 1906 die zweite Frau, die dort in Physik promovierte.Sie arbeitete in Berlin mit Max Plank und Otto Hahn auf dem Gebiet der Kernphysik und Radioaktivität zusammen. 1926 erhielt sie eine Anstellung als Professorin, musste aber als Jüdin 1938 vor den Nationalsozialisten nach Schweden fliehen. Per Post hielt sie den Kontakt zu Otto Hahn und leistete so einen wesentlichen Beitrag zur Entdeckung der Kernspaltung von Atomen. Sie war die Erste, die verstand, was auf dem Kernspaltungstisch passierte. Kernspaltungstisch Original, Inventar Nummer CD 83498. © Deutsches Museum München Den Nobelpreis für ihre gemeinsame Forschungsleistung erhielt 1944 allerdings der Chemiker Otto Hahn allein.Auf dem folgenden Bild siehst du den Versuchsaufbau, mit dem die Wissenschaftler Otto Hahn (1879-1968), Lise Meitner (1878-1968) und Fritz Straßmann (1902-1980) 1938 die Kernspaltung entdeckten. HIER findest du spannende Hintergrundinfos vom Deutschen Museum in München zu dem bedeutenden Versuch der drei Wissenschaftler*innen. Cecilia Payne-Gaposchkin (1900 – 1979) Cecilia Helena Payne Gaposchkin (1900-1979), Foto: Smithsonian Institution aus den USA, © Flickr Commons (Ausschnitt), über Wikimedia Commons Cecilia Payne gilt heute als eine der hervorragendsten Astronom*innen des vergangenen Jahrhunderts. Sie entdeckte, dass die Sterne zum größten Teil aus Wasserstoff bestehen. Aber auch ihr Weg als weibliche Wissenschaftlerin war äußerst steinig. Sie wurde von der Schule verwiesen, weil sie statt der Bibel ein Buch über Platon las. Auf Umwegen durfte sie dann doch noch ihren Studienabschluss in Botanik an einem Frauen-College in Cambridge machen. Mehrere Vorträge begeisterten sie für die Astronomie und ein Stipendium ermöglichte ihr den Wechsel nach Amerika, an die berühmte Harvard Sternwarte. Dort untersuchte die junge Frau für ihre Doktorarbeit Sternenspektren, wie sie Josef von Fraunhofer 1814 bereits von der Sonne gezeichnet hatte. Sonnenspektrum mit Fraunhoferschen Linien, Inventar Nummer BN43952 b. © Deutsches Museum München Cecilia Payne verstand als Erste, dass die Sterne vor allem aus Wasserstoff und Helium bestehen. - Eine bedeutende Entdeckung, die jedoch bei ihren männlichen Kollegen anfangs auf Widerstand stieß. Es herrschte damals die Überzeugung, dass Sterne aus den gleichen Materialien bestehen wie die Erde. Aber Cecilias Erkenntnis setzte sich durch.Wie viele andere Frauen auch, behauptete sich Cecilia Payne gegenüber all den Widerständen, die ihr im Laufe ihres Frauenlebens begegnet sind. Wenn du noch mehr solche starken Frauen kennenlernen möchtest, dann spiele unser Wissenschaftlerinnen-Memo. Memospiel "Starke Frauen" Klicke dich durch unser Memospiel mit einer kleinen Auswahl berühmter Wissenschaftlerinnen, die nur die Spitze des sprichwörtlichen Eisbergs darstellen. Unzählige weitere berühmte Wissenschaftlerinnen haben einen großen Einfluss auf die moderne naturwissenschaftliche Forschung ausgeübt und wären es wert, dass man über sie schreibt. Nachhaltigkeitsaspekte Inzwischen sind bei uns ungefähr 50 % aller Studierenden Frauen. Trotzdem ist immer noch nur ein Drittel aller in Deutschland arbeitenden Ingenieur*innen und Wissenschaftler*innen weiblich. Vor allem im Globalen Süden müssen Mädchen und Frauen auch heute noch um ihre Schulbildung kämpfen. Die SDGs der Vereinten Nationen fordern den Abbau dieser Ungleichheiten. Alle Menschen sollen die gleichen Bildungschancen haben - das ist eine zentrale Forderung des SDG 4. SDG 5 verlangt, Frauen die gleichen Chancen und Möglichkeiten auf Führungsrollen im politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben zu geben. In SDG 8 ist der Anspruch auf gleiche Bezahlung von Frauen und Männern festgehalten. Informationen zum Museum Das Deutsche Museum in München zeigt noch viele weitere Meisterwerke aus Natur und Technik. Abbildungsnachweis Titelbild: Ruhmeshalle München mit Büsten berühmter Männer. © Bayerische Schlösserverwaltung, Maria Scherf, München. Bearbeitet: Museumspädagogisches Zentrum

Valentinstag – Tag der Romantik, roten Rosen und glücklichen Pärchen? Auch in den Museen sind allerhand (ungleiche) Paare zu entdecken. Partner*in verloren? Finde die zusammengehörigen Paare im Memo-Spiel und erfahre mehr über die abgebildeten „Pärchen“. Bei unserer Bilderstrecke zeigen wir eine Reihe (ungleicher) Paare aus den Museen. Einige sind ziemlich schräg, andere sehr galaktisch oder eher standesgemäß. Informationen zu den MuseenNoch mehr zu den einzelnen Werken erfährst du in den jeweiligen Museen: Deutsches Theatermuseum, Neue Sammlung - The Designmuseum, Deutsches Museum, Alte Pinakothek, Bayerische Staatsgemäldesammlung, Antikensammlung und Glyptothek, Sammlung Schack, Städtische Galerie im Lenbachhaus sowie Bayerische Schlösserverwaltung. Abbildungsnachweis Titelbild: Ruth Geiersberger und Alfred Mehnert anlässlich einer Dadaperformance 1990 im Münchner Lustspielhaus in der Occamstraße. © Volker Derlath
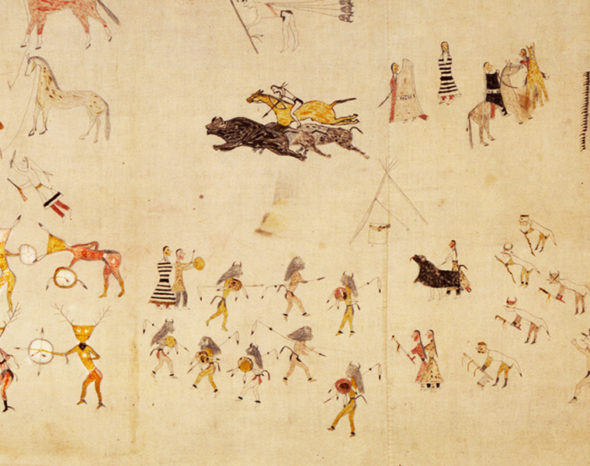
Es gibt die verschiedensten Gründe, sich zu verkleiden. Bei uns in Bayern verkleiden sich die Leute meist im Fasching. Weißt du, warum man sich an Fasching verkleidet?Früher waren die Jahreszeiten für die Menschen sehr wichtig. Im Winter konnten keine Pflanzen wachsen, also warteten die Leute auf den Frühling, der die Pflanzen wieder wachsen ließ. Dadurch hatte man dann auch wieder mehr zu essen. Um den Winter zu vertreiben, haben sich die Menschen gruselig verkleidet. Der Winter sollte sich erschrecken und endlich verschwinden.Die Menschen verkleiden sich überall auf der Welt, aber die Gründe dafür sind ganz verschieden.Bei manchen Ureinwohnern in Nordamerika verkleideten sich die Jäger als Bisons, weil sie sich so leichter an die Tiere heranschleichen konnten. Damit sie Jagdglück hatten und vor Unfällen geschützt waren, machten sie Jagdtänze, bei denen sie ebenfalls Masken trugen. Eine Abbildung von einem Jagdtanz findest du auf diesem Tipi-Lining aus dem Museum Fünf Kontinente. Tuch, sogenannter Tipi-Liner, Baumwolle, Aquarellfarben, bemalt mit Heldentaten eines Kriegers. Plains, North Dacota, Standing Rock Reservation. Um 1880. Sammlung Prinzessin Therese von Bayern © Museum Fünf Kontinente, München. Foto: Swantje Aurum-Mulzer. Tipi-Lining nennt man ein großes Bild, das man innen im Zelt, dem Tipi, aufhängte. Darauf wurden wichtige Geschichten der Familie und Rituale, wie die Jagdtänze, festgehalten. Rituale waren in diesem Fall Feste mit Tänzen, die nach bekannten Regeln abliefen. Diese Rituale waren für alle Menschen, die dort zusammenlebten sehr wichtig. Rituale gibt es auch heute noch, zum Beispiel innerhalb der Familie an Weihnachten. In Südamerika gibt es eine Gegend, die Amazonien heißt. Sie heißt deshalb so, weil sie rund um den Fluss Amazonas liegt. In einem kleinen Teil dieser Region im heutigen Brasilien, trug man zu bestimmten Anlässen auch Tanzmasken, die aus einem besonderen Papier, dem Rindenbastpapier, gemacht wurden. Dieses Papier ist so ähnlich wie Pappmaché.In der Sammlung des Museums gibt es von diesen Tanzmasken einen Piranha, einen Jaguar, einen Affen, einen Tapir und ein Reh.Welches Tier erkennst du hier? Aufsatzmaske: Reh, Tecuna (Tikuna), vor 1819, Sammlung Spix & Martius, Inv.-Nr. 388©Museum Fünf Kontinente, Foto: Nicolai Kästner Auch in Afrika trugen die Menschen aus den verschiedenen Gründen Masken. Diese Masken benutzt man auch bei bestimmten Ritualen. Manche dieser Masken waren für die Menschen so heilig, dass sie nicht von jedem gesehen werden durften.Heute werden aber auch andere Masken angefertigt. Sie werden zum Beispiel hergestellt um auf dem Kunstmarkt verkauft zu werden.Ein berühmter afrikanischer Künstler, Romuald Hazoumè, baut Masken aus Müll. Er verwendet vor allem sogenannten „Zivilisationsmüll“. Damit meint man den Müll, den wir durch unsere Art zu leben produzieren. Also Plastikflaschen, Tüten, Becher, Kanister und ähnliche Sachen, die nicht verrotten. Diesen weggeworfenen Gegenständen haucht der Künstler neues Leben ein. Eine dieser Masken siehst du hier. Recycling-Art-Maske "Dagmar Meyer", Romouald Hazoumè, Porto Novo, Republik Benin, Afrika © Museum Fünf Kontinente. Foto: Marianne Franke. Kannst du erkennen woraus diese Maske gebaut ist? Was ist denn der rote Mund wohl vorher gewesen? Und die Nase?Die Masken von Romuald Hazoumé kann man nicht tragen. Sie sind reine Kunstobjekte und werden an die Wand gehängt.Möchtest du auch einmal eine Maske aus Müll bauen? Zum Beispiel aus einer leeren Milchtüte und Bonbonpapieren? Oder aus einer leeren Spülmittelflasche, alten Kabeln und Kronkorken? Im Museum Fünf Kontinente gibt es noch mehr Masken von Romuald Hazoumè zu sehen. Wenn du Lust hast, eine Maske zu bauen, die du tragen kannst, brauchst du nur ein Stück Karton, das etwas größer als dein Gesicht ist (DIN-A4). Darauf zeichnest du mit Bleistift eine Maskengrundform (oval, rund …) Wichtig ist, dass du Löcher für die Augen einplanst, damit du mit deiner Maske etwas sehen kannst. Außen, neben den Augen, machst du mit dem Locher jeweils ein Loch, damit du eine Schnur oder ein Gummiband hindurch fädeln kannst, um die Maske am Kopf zu fixieren. Dann geht’s los mit der Gestaltung der Maske. Wie wäre es mit einer wilden Mähne aus Wolle? Vielleicht auch mit Hörnern oder scharfen, spitzen Zähnen?Im Museum Fünf Kontinente gibt es viele Masken, die du dir mit deinen Eltern zusammen anschauen kannst … ... und wenn du auf das folgende Bild klickst, gibt 's fertige Maskenvorlagen zum Ausdrucken. Passender Beitrag auf XponatMaske Passende MPZ-FührungMasken (GS, MS, RS, FöS, Inklusionsklassen, GYM, Horte) Informationen zum MuseumDas Museum Fünf Kontinente zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Kulturen aus Afrika, Amerika, Asien, Australien, dem Orient, der Südsee und Europa auf. Auf der Museumswebsite findet ihr Informationen zum Museum und seinen Ausstellungen. Abbildungsnachweis Titelbild: Tuch, sogenannter Tipi-Liner (Ausschnitt), Baumwolle, Aquarellfarben, bemalt mit Heldentaten eines Kriegers, Plains, North Dacota, Standing Rock Reservation, m 1880, Sammlung Prinzessin Therese von Bayern (Ausschnitt). © Museum Fünf Kontinente, München. Foto: Swantje Aurum-Mulzer, Bearbeitet: Museumspädagogisches Zentrum
© Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek München, Foto: Renate Kühling, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum Die Aufgaben einer griechischen Frau waren vor 2500 Jahren: Kinder erziehen, kochen, Wasser holen, Wolle verarbeiten, Sklaven ausbilden, die Gräber pflegen und sich um die Erinnerung an die Toten kümmern. Einige dieser Aufgaben gehören (leider) heute noch zum Klischeebild einer Frau. Keinesfalls durften Frauen in der Antike zur Schule oder alleine ins Theater gehen, an Wahlen teilnehmen oder reiten. Aber es gab damals auch schon Frauen, die sich von den meisten anderen unterschieden. Sie hatten besondere Aufgaben in bestimmten Bereichen: Priesterinnen, Dichterinnen, Königinnen und Hetären (Prostituierte, die hoch gebildet und sozial anerkannt waren; oft Begleiterinnen von bekannten Personen des öffentlichen Lebens). Eine sagenumwobene Gruppe von besonders starken Frauen waren in der Antike die Amazonen. Sie galten als außerordentlich mutig und wollten von Männern nichts wissen. Sie ritten auf Pferden, kämpften mit Waffen und taten auch sonst vieles, was im Verständnis der Zeit eigentlich Aufgabe der Männer war. Wir wissen heute nicht, ob es die Amazonen jemals wirklich gab. Vielleicht waren es Frauen, die als Steppenvolk im Norden der heutigen Türkei lebten. Als ihr Stammvater gilt Ares, der „Haudrauf“-Kriegsgott. Gestalte deine eigene Amazonen-Vase Obwohl man nicht weiß, ob es sie wirklich gab, werden auf antiken Vasen oft Amazonen dargestellt. Wie gestaltest du deine Amazonen-Vase? Ziehe die einzelnen Elemente auf die Vase und positioniere sie nach Belieben darauf. Die Aussage des Bildes verändert sich je nachdem, was und wohin du die Elemente setzt. Probiere es aus! Amazonen stehen für Stärke. Feministische Bewegungen greifen heute häufig auf das Bild der Amazone zurück, um sich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau einzusetzen. Jede*r von uns hat Stärken, die ganz unterschiedlich sein können. Sie müssen nach unserem heutigen Verständnis allerdings nicht unbedingt mit körperlicher Kraft und Kampfbereitschaft zu tun haben. Was sind denn deine Stärken? Lade dir die Vorlage herunter und gestalte deine ganz persönliche Vase. Vase Pdf-Vorlage Hier hast du zwei Beispiele, an denen du dich orientieren kannst: Vorlage Vase. © Pixabay, Ausgestaltung: Museumspädagogisches Zentrum Vorlage Vase. © Pixabay, Ausgestaltung: Museumspädagogisches Zentrum Nachhaltigkeit Das Bild der Amazone wurde im Laufe der Zeit immer wieder neu interpretiert und genutzt. Feministinnen nutzen es z. B. als Symbol für Stärke und Autonomie. Ein wichtiges Thema ist dabei die Geschlechtergleichheit (Ziel 5) und das Hinterfragen von Rollenzuschreibungen, um in Frieden und Gerechtigkeit leben zu können (Ziel 16). Passende Beiräge auf XponatTonkrug, Dekonstruktion, Collage Passende MPZ-FührungFrauen in der Antike (MS, RS, GYM, BS) Informationen zum MuseumVasen, worauf Amazonen und ihre Geschichten abgebildet sind findest du in der Staatlichen Antikensammlung in München. Schau vorbei! Abbildungsnachweis Titelbild: © Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek München. Foto: Renate Kühling, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum
Geleitet durch einen Stern, kamen drei Sterndeuter aus dem Morgenland, um dem neugeborenen König der Juden die Ehre zu erweisen – so wird in der Bibel bei Mt 2,1–12 berichtet. In der Kunst werden sie seit dem Mittelalter als Könige dargestellt, die entweder durch unterschiedliche Hautfarbe oder drei Lebensalter Symbol für die gesamte Menschheit sind. Die Heiligen Drei Könige nehmen ihre Kronen ab und bringen dem kleinen Jesus Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Bei Rogier van der Weyden tragen die drei Männer kostbarste Gewänder des 15. Jahrhunderts, ihre Kronen sind erst auf den zweiten Blick zu entdecken. Typisch für die Malerei der Alten Niederländer: In zahllosen Details stecken Bedeutungen. Wir wollen die Aufmerksamkeit auf den Stern lenken, den Rogier van der Weyden am nach oben dunkler werdenden Himmel malte, halb verdeckt durch den ruinösen „Stall“, hinter dem er aufblitzt. Dieser Stern inspiriert uns zu einer Weihnachtskarte. Du brauchst: Dunkelblaues Tonpapier im Format DIN A5 oder eine dunkelblaue Doppelkarte Einen gut gespitzten Farbstift in Gold, Silber, Weiß oder Gelb Natürlich lassen sich auch Postkarten, kleine Geschenkanhänger oder Geschenkpapier mit solchen Sternen gestalten. So geht’s (siehe dazu auch den Bilder-Slider unterhalb): Leicht schräg auf das blaue Papier einen geraden Strich ziehen. Senkrecht dazu einen zweiten Strich ziehen, der genauso lang ist und den anderen genau in der Mitte teilt. Ein gleichschenkliges Kreuz ist entstanden. In alle Zwischenräume Striche ziehen, so dass ein Stern aus acht Strahlen entsteht. Nun kommen deutlich kürzere Striche zwischen die einzelnen Strahlen. Start für das Ziehen der Striche ist jeweils der Kreuzungspunkt. Im letzten Schritt in alle 16 Zwischenräume von der Mitte aus Striche ziehen, die den Zwischenraum jeweils halbieren und in der Länge zwischen den kurzen und den langen liegen. Tipp: Besonders schön sieht es aus, wenn du die acht langen Strahlen noch einmal von innen nach außen nachziehst. Dazu den Stift in der Mitte aufsetzen und dann nach außen ausgleiten lassen. Weitere Sterne nach dem gleichen Vorgehen zeichnen. Tonpapier zu einer Karte falten. Das Gemälde bietet aber noch mehr Anregungen! Sieh dir die Kleidung der Könige und ihre kostbaren Hüte genauer an. Zeichne einige Details ab oder lass dich zu eigenen Modekreationen und Stoffmustern anregen! Eine Zeitreise mit allen Sinnen Wenn du dich noch länger mit dem Gemälde beschäftigen magst, begib dich auf eine Gedankenreise. Welche Geräusche könntest du dir in der dargestellten Szene vorstellen, welche Gerüche wären denkbar? Schau dir dazu auch den Hintergrund an!Rogier van der Weyden hat seine Darstellung der Geschichte in die eigene Zeit und in seine Gegend geholt – ins 15. Jahrhundert in Mitteleuropa. Das war in der Malerei über viele Jahrhunderte üblich. So hat Paul Gauguin die Weihnachtsgeschichte in die Südsee verlegt. Und auch heute gibt es Weihnachtskrippen, die oberbayerischen Ställen nachempfunden sind oder mit Kunststofffiguren aus dem Kinderzimmer bestückt sind. Rogier van der Weyden, Columba-Altar: Anbetung der Könige, um 1455, Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek München, CC BY-SA 4.0 Passender Beitrag auf XponatExpertentipp Passende MPZ-Online-Veranstaltung MusPad: Die Weihnachtsgeschichte (alle Schularten und Jgst.) Passende MPZ-FührungDie Weihnachtsgeschichte (Horte, MS, RS, GS, GYM, BS)Die Weihnachtsgeschichte (Kinder ab 5 Jahren) Informationen zum Museum Starte deinen virtuellen Rundgang durch die Alte Pinakothek in Saal I im Obergeschoss, in dem sich die Altniederländische Malerei befindet. Weitere Gemälde zum Thema findest du in der Online-Sammlung der Bayerische Staatsgemäldesammlungen unter dem Suchbegriff „Anbetung“. Abbildungsnachweis Titelbild: Rogier van der Weyden, Columba-Altar: Anbetung der Könige (Ausschnitt), um 1455, Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Alte Pinakothek München, CC BY-SA 4.0, Bearbeitet: Museumspädagogisches Zentrum

Wohnen früher in München Wie wir wohnen, das ist mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Doch was brauchen wir denn eigentlich alles zum Wohnen? Fun Fakt: Umziehen ist hier wirklich ein´ ziehen!1911, Anonym. © Münchner Stadtmuseum Schau mal hier, ein ganz alltägliches Straßenbild der Prinzregentenzeit (1886-1912) in dem die beiden all ihren Besitz durch München karrten. Da damals die Mietpreise unbezahlbar waren, mussten vor allem viele Bürger der unteren Schichten ständig umziehen. Und dabei passte ihr ganzer Hausstand auf einen Handkarren. Unglaublich oder? Doch nicht nur das. Kannst du dir vorstellen dein Bett im Schichtsystem zu teilen? Oder das in einem 15 Quadratmeter Raum deine Küche, Badezimmer, Wohnzimmer, Kinder- und Schlafzimmer Platz finden? Dabei ist der Tisch nicht nur zum Essen vorgesehen, sondern dein Schreibtisch, die Werkbank, Waschbecken (für einen selbst wie auch für die Wäsche) und Wickeltisch zugleich. Das kannst du dir nicht vorstellen? Dann schau dir unseren Film an und tauche ein in die unglaubliche Art wie man z.B. Anfang des 20. Jahrhunderts in München wohnte: Und jetzt stell dir einmal vor wie es wäre, wenn du umziehst und alle deine Sachen und Möbel, die du zum Wohnen brauchst, auf einen Handkarren passen müssten... Unvorstellbar? Machen wir doch mal eine Probe: was brauchst du wirklich zum Wohnen? Schau dich zu Hause um und überlege welche Gegenstände du wirklich brauchst. Und zur Anregung ein paar verschiedene Wohnformen, die es in der Geschichte weltweit gab und auch noch heute gibt. Auf welche wohn Ideen man so kommen kann, zeigen wir dir dann in unserem nächsten Beitrag. Dort siehst du dann, wie man nachhaltig, minimalistisch, aber mit allem was man braucht, in seinem mobilem Zuhause leben kann. NACHHALTIGKEIT Die Vereinten Nationen haben gemeinsam 17 Ziele für eine nachhaltige Welt beschlossen, die bis zum Jahr 2030 von allen Nationen umgesetzt werden sollen. Ziel 11 besagt, alle Menschen sollen Zugang zu angemessenem Wohnraum und zu Grundversorgung haben. Doch was passiert, wenn die Wohnungen immer teurer und nicht mehr bezahlbar sind? HIER findest du alle 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mit Erklärungen in leichter Sprache.Passende MPZ-FührungenWohnen, trinken, speisen – wie Münchner Familien lebten (GS) Informationen zu den MuseenIn der Ausstellung „Typisch München“ im Münchner Stadtmuseum kannst du noch mehr zu München und vor allem auch den im Film gezeigten Objekte erfahren und sie dir einmal persönlich anschauen. Und wenn du dir einmal selbst ein Bild davon machen möchtest, wie es sich so angefühlt haben muss in einem kleinen Zimmer mit mehreren Personen zu wohnen, dann schau doch im Üblacker Häusl vorbei. Passender Beitrag auf XponatLastkarrenAnmerkung für Lehrkräfte, Museumspädagog*innen und Vermittler*innenAnhand des Films lassen sich auch aktuelle Bezüge zu dem globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen in Hinblick auf nachhaltige Städte (Ziel 11) herstellen und gemeinsam mit den Schüler*innen auch Themen wie bezahlbares und ökologischeres Wohnen besprechen. Abbildungsnachweis Titelbild: Filmausschnitt "Historisches Wohnen in München". © Museumspädagogisches Zentrum.
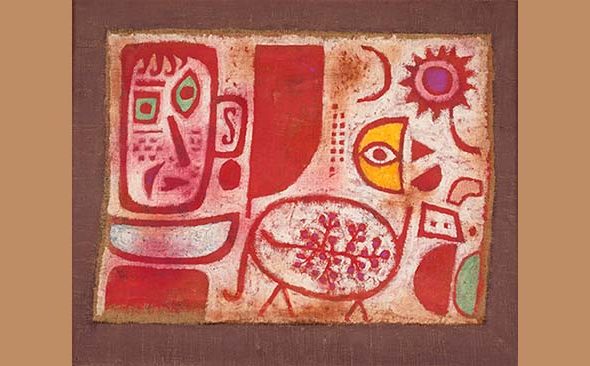
Wie schnell sich eine Geschichte verändern kann, zeigt dieses Experiment: Ordne die Bestandteile eines Gemäldes von Paul Klee zu einem Bild. Verschiebe sie und probiere verschiedene Varianten aus! Wenn du fertig bist, mach einen Screenshot und speichere ihn ab. Vergleiche nun dein Werk mit „Rausch“ von Paul Klee. Welche Geschichten werden jeweils erzählt? Oder erzählt dein Bild vielleicht gar keine Geschichte? Paul Klee, Rausch, 1939, 341 (Y 1), Wasserfarbe, Öl auf Jute, 65 x 80 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Dauerleihgabe der Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München, CC BY-NC-SA 4.0 Paul Klee hat „Rausch“ übrigens auf ein grobes Jute-Gewebe gemalt, was an der Struktur deutlich sichtbar ist. An vielen Stellen blieb der braune Untergrund frei. Passende MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Tanzende Formen, fantastische Träume und farbige Klänge. Künstler*innen um den Blauen Reiter (GS ab Jgst. 2, MS bis Jgst. 8, RS bis Jgst. 8, GYM bis Jgst. 8) Passende MPZ-FührungExperimentierwerkstatt Farbe (GS ab Jgst. 3, MS, RS und GYM jeweils bis Jgst. 7Menschen, Köpfe – von realistisch bis abstrakt (GS, Horte, MS, RS, GYM, BS)Erzählen, schreiben, dichten ... (GS ab Jgst. 3, MS bis Jgst. 7)Passender Beitrag auf XponatKonstruktion Informationen zum MuseumDie Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau beherbergt die bedeutendste Sammlung zur Kunst um den Blauen Reiter. Auch was gerade nicht ausgestellt ist, findest du in der Online-Sammlung. Abbildungsnachweis Titelbild: Paul Klee, Rausch, 1939, 341 (Y 1), Wasserfarbe, Öl auf Jute, 65 x 80 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Dauerleihgabe der Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München, CC BY-NC-SA 4.0, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum
Von Schüler*innen für Schüler*innen ... Da uns eine gerechte und nachhaltige Welt sehr am Herzen liegt, möchten wir, das Robotic-Team MAI des Gymnasiums Markt Indersdorf, Kindern und Jugendlichen die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen näher bringen. Dabei wollen wir jedes Ziel mit Informationstexten, Rätseln und interaktiven Spielen vorstellen und vor allem „be-greifbar“ machen. So vermitteln wir möglichst vielen Menschen Informationen über die Nachhaltigkeitsziele und treiben diese mit voran! Wir beginnen unsere Reihe mit dem Nachhaltigkeitsziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden. © Partizipatives Schüler*innen-Projekt "Mobiles Museum", Gymnasium Markt Indersdorf und Museumspädagogisches Zentrum Teste deinen ökologischen Fußabdruck, baue ein Insektenhotel und/oder gestalte deine eigene nachhaltige Stadt! Vom Museumspädagogischen Zentrum für Lehrkräfte ... das Nachhaltigkeitsziel im Museum entdecken Anhand eines mittelalterlichen Stadtmodells können verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit thematisiert werden. Dabei spielen die Grünflächennutzung, wie auch Fragen zur sozialen Gerechtigkeit, zu Gesundheit und Mobilität oder zu Müllaufkommen und -vermeidung eine große Rolle. Auf diese Weise lassen sich anhand eines Exponats verschiedene Nachhaltigkeitsziele veranschaulichen, wie etwa das SDG 11. Der Beitrag #MyGreenCity - wie grün ist meine Stadt? liefert vertiefende Informationen dazu. © Bayerisches Nationalmuseum, München BeispielexponatModell der Stadt München | 1570Von Jakob SandtnerBayerisches Nationalmuseum, München Der Straubinger Drechslermeister Jakob Sandtner schuf im Auftrag von Herzog Albrecht V. von Bayern Modelle von fünf bayerischen Städten, neben München noch Burghausen, Ingolstadt, Landshut und Straubing. Ursprünglich waren sie in der herzoglichen Kunstkammer ausgestellt, heute befinden sie sich im Bayerischen Nationalmuseum. Wie aktuelle archäologische Ausgrabungen bestätigen, sind die Modelle maßstabsgerecht ausgearbeitet. In das Modell Münchens fügte man unter Kurfürst Maximilian einige Neubauten des 17. Jhs. ein (u. a. den Kaisertrakt der Residenz und die Michaelskirche mit Jesuitenkolleg). Alle fünf ehemaligen Residenzstädte zeigen eine Kopie ihres Modells im jeweiligen Stadtmuseum. Informationen zum MuseumWenn du mehr über das Stadtmodell von Sandtner, die Nutzung der Grünflächen und die Geschichte unserer Stadt erfahren möchtest, mach doch mal einen Ausflug in das Münchner Stadtmuseum oder du schaust dir gleich das originale Stadtmodell im Bayerischen Nationalmuseum an. Informationen Partizipatives Schüler*innen-Projekt "Mobiles Museum" Von einer MPZ-Führung inspiriert, haben Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Markt Indersdorf einen digitalen Museumskoffer zum Thema Nachhaltigkeit und Museum entworfen. In diesem Kooperationsprojekt mit dem MPZ möchten sie möglichst vielen Menschen Informationen bezüglich der Nachhaltigkeitsziele vermitteln und zum Mitmachen einladen. Lerne die Gruppe MAI Robotics gerne in diesem Video kennen: Abbildungsnachweis Titelbild: SDG 11 Symbol, Nachhaltige Stadt "environmental protection" und Weltkugelfigur. © Partizipatives Schüler*innen-Projekt "Mobiles Museum", Gymnasium Markt Indersdorf; pixabay, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum (MPZ)
Für den Klimaschutz fand im Juni 2021 das Münchner Stadtradeln statt und das MPZ war wieder dabei. Wir nutzten die Gelegenheit und starteten während der Aktion immer mittwochs eine „Museumsradltour“ mit unserem MPZ-Lastenrad.Bei unserem Ausflug zum Thema „München und die Welt“ führt uns Susie vom Deutschen Museum entlang der Isar zum Museum Fünf Kontinente. Es geht von München nach Japan und Südamerika! Zu sehen gab es das Video bereits in unserer Story auf Instagram. Und wir radeln weiter – durch die Natur und durch die Museumslandschaft Münchens – vorbei am Deutschen Museum, dem Museum Fünf Kontinente, den Pinakotheken, dem Lenbachhaus und, und, und ... Hast du Lust auf ein kleines Südamerika-Quiz? Dann klicke HIER. STADTRADELN Bei der jährlichen, bundesweiten Aktion geht es darum, 21 Tage lang privat und beruflich möglichst viele Kilometer klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. So soll gemeinsam ein Zeichen gesetzt werden für mehr Umweltschutz, mehr Radförderung und mehr Lebensqualität in den Kommunen. Mitmachen können alle, die in einer teilnehmenden Kommune wohnen, arbeiten, in einem Verein tätig sind oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Unter www.stadtradeln.de können sich alle Teilnehmenden registrieren, einem bereits vorhandenen Team der Kommune beitreten oder ein eigenes Team gründen. NACHHALTIGKEIT 17ziele.de 17ziele.de 17ziele.de Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten (Ziel 11) sowie umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seinen Auswirkungen ergreifen (Ziel 13) und Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern (Ziel 15), sind drei der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen! Informationen zu den MuseenDas Deutsche Museum gehört weltweit zu den bedeutendsten Technik- und Wissenschaftsmuseen. Möchtest du mehr erfahren über Chemie, Physik, Mineralogie, Luft- und Raumfahrt und vieles mehr? Dann schau vorbei!Im Museum Fünf Kontinente kannst du Gegenstände von Menschen aus der ganzen Welt sehen. Es ist ein ethnologisches Museum. Ein Besuch lohnt sich! Abbildungsnachweis Titelbild: Filmstils #MPZradelt – München und die Welt © Museumspädagogisches Zentrum

Vor 40 Jahren, im Juni 1981 berichtete eine amerikanische Fachzeitschrift zum ersten Mal über eine mysteriöse Erkrankung, die später unter dem Namen AIDS bekannt werden sollte.Zuerst bei Drogenabhängigen und homosexuellen Männern diagnostiziert, wurden diese ohnehin als Randgruppen gebrandmarkten Menschen mit zusätzlichen Vorurteilen und Repressionen belegt. Mit dem HI-Virus infizierte Menschen erlebten jahrelange Ausgrenzung, Anfeindungen und Abwertungen. Offizielle Äußerungen von politischen Akteur*innen forderten angesichts der durch Tests verstärkt nachgewiesenen Krankheitsfälle die Absonderung von HIV-infizierten Menschen in Lagern oder deren Kennzeichnung mit Tätowierungen. Unglaublich, aber wahr! AIDS-Demonstration auf dem Münchner Odeonsplatz 1987 und Mahnwache auf dem Münchner Marienplatz 1987. © Volker Derlath Welche Gedanken hast du, wenn du solche Parolen liest? Die beiden Fotos verdeutlichen den Widerstand gegen die damalige Politik und die Gefährlichkeit der vehementen Ausgrenzung und Stigmatisierung. Die politische Rhetorik erlaubt durchaus Parallelen zur Zeit des Nationalsozialismus zu ziehen, in der homosexuelle Männer in Konzentrationslager eingewiesen wurden. Dort mussten sie an ihrer Sträflingskleidung einen rosafarbenen Winkel, eigentlich ein Dreieck, tragen. Die Forderung der Schwulenbewegung auf dem Demonstrationsbanner nach Schutz vor der AIDS-Politik hatte also ihre Berechtigung. Welche Formen von Ausgrenzung kennst du? Wie können wir ihnen begegnen? Die rote AIDS-Schleife steht als Symbol für die Solidarität mit HIV-positiven und AIDS-kranken Menschen. © www.aidshilfe.de Zwar gründete sich 1983 auf private Initiative die „Deutsche Aidshilfe“, aber noch ohne jegliche Unterstützung durch die Politik. Sie entstand als Reaktion auf die verheerende Situation und die vielen Toten in den USA. Erst Anfang der 90er Jahre kam es zu einem allmählichen Bewusstseinswandel – innerhalb der Politik und auch der Bevölkerung, der 1987 durch die erfolgreiche, von der damaligen Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth (CDU) angestoßenen Aufklärungskampagne „Gib AIDS keine Chance“ seinen Anfang nahm. Die damalige Aktion trug auch zur Erkenntnis bei, dass es jeden treffen kann, ob hetereo- oder homosexuell. Einen Impfstoff gibt es bis heute nicht, jedoch sehr gute Medikamente, die den Infizierten ein normales Leben ermöglichen. Allerdings sieht die Situation in vielen Ländern dieser Welt ganz anders aus! Ist dir diese Säule in der Münchner Innenstadt schon einmal aufgefallen? Aidsmemorial am Sendlinger-Tor in München von Wolfgang Tillmans, 2002, Gif Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum, Foto: Judith Schenk Sie steht am Sendlinger Tor, einem der Verkehrsknotenpunkte in München und scheint einer anonymen Reihung von gefliesten Säulen aus den Münchner U-Bahnhöfen entnommen zu sein. Beim Lesen der Inschrift erkennst du die eigentliche Bedeutung als AIDS Memorial. Mit „heute“ ist der Zeitpunkt der Aufstellung im Jahr 2002 gemeint. Doch auch zwanzig Jahre danach ist das Werk des politisch aktiven Künstlers Wolfgang Tillmans aktuell wie eh und je. Einen Schlussstrich gibt es nicht – bis jetzt. Vielmehr mahnt die Säule zu Erinnerung, Prävention und Solidarität. Zahlreiche Künstler*innen, öffentliche und private engagier(t)en sich zu dem Thema Aids auf ganz unterschiedliche Art und Weise. „Das Sehen an sich ist ein Nachdenken über die Welt.” Wolfgang Tillmans. Einen lebendigen Eindruck von der Münchner Schwulenszene der 80er Jahre findest du in einem Video der Monacensia. Thomas Niederbühl ist seit 1996 für die Rosa Liste im Münchner Stadtrat. Er ist auch Geschäftsführer der „münchner aids-hilfe“: Wie wirkt das folgende Bild auf dich?Schräg? Schrill? Ungewöhnlich? Fröhlich? Bedrohlich? Oder beides? Typisch Keith Haring? Keith Haring, Untitled (Self-Portrait), 1985, Udo und Anette Brandhorst Sammlung, Foto: Haydar Koyupinar, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München, Keith Haring artwork. © Keith Haring Foundation Untypisch ist allerdings, dass sich der US-amerikanische Künstler und politische Aktivist (1958-1990) hier selbst darstellt: im Jahr 1985, zu einer Zeit, in der er bereits etliche Freunde an AIDS verloren hatte und sich seine Bildsprache wandelt und verdüstert. Pink und neongrün? Trage deine Ideen hier in unserer Wortwolke ein. Wenn Vorschläge öfter genannt werden, erscheinen sie entsprechend größer. Du kannst auch mit deiner Handykamera diesen Code scannen! M0001845 John Haygarth. Line engraving by W. Cooke, 1827, after J. H..Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images.images@wellcome.ac.uk.http://wellcomeimages.org.John Haygarth. Line engraving by W. Cooke, 1827, after J. H. Bell..Line engraving.Gent\'s magazine.Published: 1827..Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Übernimmt Keith Haring hier selbst die Stigmatisierung, die Brandmarkung? So seht ihr uns, als Gift und Gefahr für die Gesellschaft? Dahinter aber steht ein Mensch, der sich outet und uns direkt in die Augen blickt! Selbst homosexuell, lebte Haring im vollem Bewusstsein der Gefahr, zu erkranken. Noch vor seiner Diagnose setzte er sich für die AIDS-Kranken ein, für mehr Aufklärung und Mitgefühl, ein großes Manko auch in den USA. Die Schwulen wurden hier – wie im Rest der Welt – ausgegrenzt, die Krankheit als „Schwulenseuche“ und „Schwulenkrebs“ abgetan; Forschungsgelder waren Mangelware. Im Alter von 31 Jahren erlag er den Folgen der Infektion, mit der er außergewöhnlich offen und mutig umgegangen war und so zu ihrer Enttabuisierung beigetragen hatte. Kurz vor seinem Tod gründete er die „Keith Haring Foundation“ mit dem Ziel, neben der Unterstützung benachteiligter Kinder auch einen bewussten vorurteilsfreien Umgang mit HIV und AIDS zu schaffen. Neben der New Yorker Graffiti-Szene, Comics, Trickfilmen, Breakdance und Hieroglyphen waren es also auch Missstände, die Keith Haring antrieben und zu seiner Kunst inspirierten: Homophobie, Stigmatisierung und Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Religion oder Sexualität, Krieg, atomare Aufrüstung oder Umweltverschmutzung – Themen aktueller denn je! (Museum Brandhorst) WAS BEWEGT DICH? WAS TREIBT DICH AN? WAS INSPIRIERT DICH? WAS MACHT DICH WUETEND? Keith Haring glaubte dennoch an das Gute im Menschen und an die Kraft der Kunst, Ungerechtigkeiten aufzuzeigen, wachzurütteln, sichtbar zu machen, und gleichzeitig Balsam zu sein: „Kunst sollte etwas sein, das die Seele befreit, die Fantasie anregt und die Menschen ermuntert, weiter zu gehen. Sie feiert die Menschheit, statt sie zu manipulieren.“ (Keith Haring) Deine Meinung? Teile sie gerne mit uns auf Instagram oder Facebook und verwende den Hashtag #PopPunkPolitik! Alle Beiträge zu der Reihe PopPunkPolitik findet ihr HIER. Und Lust auf ACTION?Kreative Anregungen zum Denken, Diskutieren und kreativen Gestalten findest du auf unseren ActioncARTS, eine Kooperation mit dem Museum Brandhorst: Ohne Worte kommunizieren (deutsch / englisch)Urban und öffentlich (deutsch / englisch) In der Serie #MBCloseUp wirft das Museum Brandhorst einen genauen Blick auf das Selbstporträt von Keith Haring. Passender Beitrag auf XponatOhne Worte kommunizieren Passende MPZ-Führung„Food for the mind“ – sehen, denken, diskutieren (MS ab Jgst. 8, RS ab Jgst. 8, GYM ab Jgst. 8,BS)Kunst ist politisch (MS, RS, GS ab Jgst. 3, GYM, Horte, BS)Kunst und Kommunikation (RS ab Jgst. 9, GYM ab Jgst. 9)Mittelschulprogramm: Was macht zeitgenössische Kunst … und was hat das mit mir zu tun? (MS)Vielfalt entdecken – Die (Kunst-)Welt ist bunt! Mit dem MPZ gegen Fremdenfeindlichkeit! (MS; RS, FöS, GS ab Jgst. 3, GYM, Horte, Inklusionsklassen, BS) Informationen zum MuseumDie Monacensia im Hildebrandhaus ist das literarische Gedächtnis der Stadt München. Neben dem Literaturarchiv ist hier eine Forschungsbibliothek zur Geschichte und zum kulturellen Leben Münchens untergebracht.In der Sammlung des Museums Brandhorst kannst du weitere Werke von Keith Haring und anderen politisch aktiven Künstler*innen ab Ende der 50er Jahre bis heute entdecken! Abbildungsnachweis Titelbild: Plakatmotiv zu Pop Punk Politik – die 1980er Jahre in München (Ausschnitt). © Monacensia im Hildebrandhaus, Keith Haring, Untitled (Self-Portrait), 1985, Udo und Anette Brandhorst Sammlung, Foto: Haydar Koyupinar, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München, Keith Haring artwork. © Keith Haring Foundation und AIDS-Demonstration auf dem Münchner Odeonsplatz 1987. © Volker Derlath
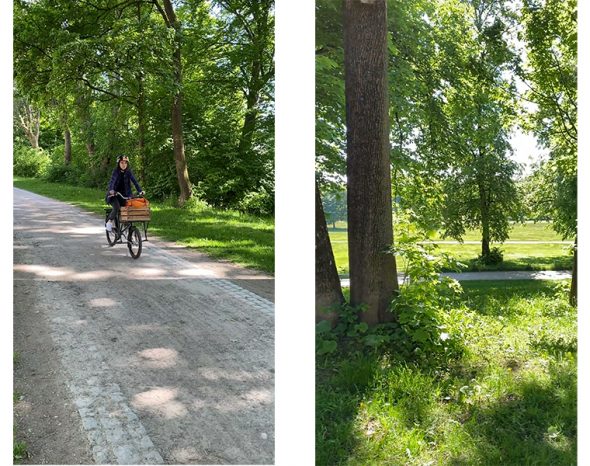
Für den Klimaschutz fand im Juni 2021 das Münchner Stadtradeln statt und das MPZ war wieder dabei. Wir nutzten die Gelegenheit und starteten während der Aktion immer mittwochs eine "Museumsradltour" mit unserem MPZ-Lastenrad. Zum Thema „Green City“ führt uns Georgina bei unserem ersten Ausflug vom Englischen Garten zum Münchner Stadtmuseum. Zu sehen gab es das Video bereits in unserer Story auf Instagram. Und wir radeln weiter - durch die Natur und durch die Museumslandschaft Münchens - vorbei am Deutschen Museum, dem Museum Fünf Kontinente, den Pinakotheken und, und, und ... STADTRADELN Bei der jährlichen, bundesweiten Aktion geht es darum, 21 Tage lang privat und beruflich möglichst viele Kilometer klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. So soll gemeinsam ein Zeichen gesetzt werden für mehr Umweltschutz, mehr Radförderung und mehr Lebensqualität in den Kommunen. Mitmachen können alle, die in einer teilnehmenden Kommune wohnen, arbeiten, in einem Verein tätig sind oder eine (Hoch-)Schule besuchen. HIER geht's zur Registrierung, man kann einem vorhandenen Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Du möchtest mehr darüber erfahren wie 'grün' München ist? Dann lies HIER weiter. NACHHALTIGKEIT 17ziele.de 17ziele.de 17ziele.de Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten (Ziel 11) sowie umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seinen Auswirkungen ergreifen(Ziel 13) und Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern (Ziel 15), sind drei der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen! Informationen zu den MuseenDas Haus der Kunst ist ein Ausstellungsgebäude in der Prinzregentenstraße, südlich des Englischen Gartens. Bist du neugierig, was dich im Haus der Kunst erwartet? Noch mehr Informationen zur Stadt München und ihrer Geschichte findest du im Münchner Stadtmuseum. Abbildungsnachweis Titelbild: Filmstils "#MPZradelt – My Green City". © Museumspädagogisches Zentrum
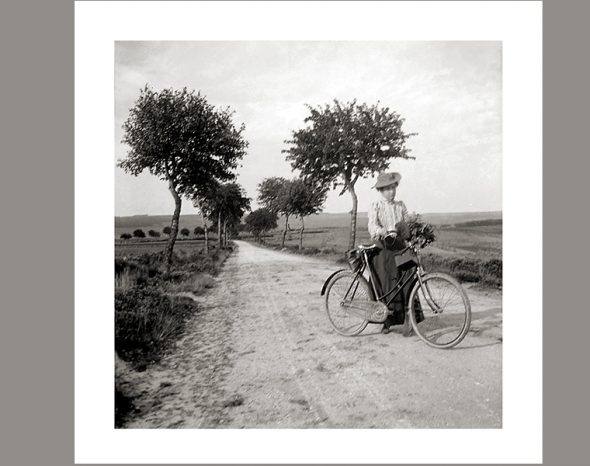
Gabriele Münter wollte Kunst studieren. Und sie hatte ein Fahrrad. Doch zu Beginn des 20. Jahrhundert bedeutete beides für eine Frau keine Selbstverständlichkeit. Kunststudium für Frauen um 1900 Frauen, die um 1900 Kunst studieren wollten, hatten es nicht leicht. Denn das Studium an staatlichen Akademien war Frauen nicht möglich. Als Gabriele Münter 1901 nach München kam, blieb ihr nur die Damenakademie des Künstlerinnenvereins. Doch zufrieden war Gabriele Münter mit dem Zeichenunterricht dort nicht. Sie wechselte zur Phalanx, einer Künstlergruppe, die auch eine private Kunstschule unterhielt – für Damen und Herren. Dort erlernte Münter verschiedene Maltechniken. Mit Kandinsky unterwegs Künstlerischer Leiter der Phalanx war Wassily Kandinsky. Münter radelte mit Kandinsky in die nähere und weitere Umgebung, malte mit ihm in der Natur. Sie lernten sich näher kennen und wurden ein Paar. Links nach rechts: Wassily Kandinsky, Kallmünz – Gabriele Münter beim Malen I, Sommer 1903 und Wassily Kandinsky, Kallmünz – Gabriele Münter beim Malen II, Sommer 1903, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Gabriele Münter Stiftung 1957, CC BY-SA 4.0 Die Beiden waren mit dem Skizzenbuch, mit Staffelei, Malpappe, Pinsel, Palette und Tubenfarben unterwegs oder hatten den Fotoapparat dabei. Sie hielten direkt vor Ort Licht- und Farbstimmungen fest und schufen abstrakte Bilder ihrer Umgebung. Zahlreiche kleinformatige Gemälde und Fotos lassen uns in diese Zeit eintauchen.Zu sehen sind ihre Arbeiten aus den Jahren 1902 bis 1908, die im Freien entstanden, in einer 360°-Tour „Unter freiem Himmel des Lenbachhauses. Noch mehr zu Gabriele Münter findest du in der Online-Sammlung des Lenbachhauses. Mit der Bux aufs Rad Was das Fahrradfahren anging, war München um 1900 fortschrittlich. Denn München galt damals bereits als Hochburg des Radsports. Frauen auf dem Rad waren im Englischen Garten keine Seltenheit. Dabei war Radfahren doch etwas für Männer ...! Nicht allein die Damenmode mit engen Schnürkorsetts machte den Frauen das Fahrradfahren eigentlich unmöglich. Deshalb schneiderte sich so manch Fahrradbegeisterte selbst die passende Kleidung, die dann deutlich mehr Bewegungsfreiheit mit sich brachte. Die so genannte Radbux war geboren. Sie kombinierte die beiden Beine einer Hose mit der Figur umspielenden Weite eines Rockes. Aber auch andere bequemere Kleidung entstand in der Zeit um 1900 und lockerte die gesellschaftlichen Zwänge. So unterstützte auch die Reformkleiderbewegung die Freiheiten der Frauen.Zum Malen trug Gabriele Münter übrigens einen langen Malkittel, um ihre Kleidung vor Farbe zu schützen. Den siehst du oben. Wassily Kandinsky, Gabriele Münter mit dem Fahrrad auf einem Feldweg, um 1903, Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München Eine Reihe von Kandinskys Fotografien zeigen Gabriele Münter. Mach dich bei deiner 360°-Tour auf die Suche nach der Mode, die Münter gerne trug! Oder entwirf eine Kollektion für radlfahrende Damen um 1900! Fahrräder aus der Zeit kannst du übrigens im Verkehrszentrum des Deutschen Museums sehen. Ein Blick ins Fotoalbum Stöbere doch mal in den Fotoalben deiner Urgroßeltern! Findest du deine Vorfahren mit einem Fahrrad fotografiert? Und welche Kleidung trugen sie am Beginn des 20. Jahrhunderts, wenn sie wanderten, radelten oder beruflichen Tätigkeiten nachgingen? NACHHALTIGKEIT 17ziele.de Geschlechtergleichheit (Ziel 5) ist eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen! Bildung, eine künstlerische Ausbildung oder die Ausübung eines Sportes sollten allen Geschlechtern gleichermaßen offenstehen. Doch selbst Kleiderzwänge können hierbei ein Hindernis darstellen. Passende MPZ-Führung Frauenpower (MS ab Jgst. 7, RS ab Jgst. 7, GYM ab Jgst. 7, BS)Künstlerinnen (RS, GYM) Passender Beitrag auf Xponat Kontextualisierung Informationen zum Museum Die Städtische Galerie im Lenbachhaus ist berühmt für ihren Sammlungsbestand Der Blaue Reiter. Gabriele Münters Schenkung lieferte hierzu einen wichtigen Beitrag. Abbildungsnachweise Titelbild: Wassily Kandinsky, Gabriele Münter mit dem Fahrrad auf einem Feldweg, um 1903, Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München

Dieses Zelt kannst du im Neuen Schloss in Ingolstadt bewundern – es gehörte dem osmanischen Großwesir Sari Süleyman Pasa. Was es damit auf sich hat, kannst du erforschen, indem du auf die Markierungen klickst. Hast du denn schon einmal selbst ein größeres Zelt aufgebaut? Das kann ganz schön kompliziert sein. Wie das zwölfeckige Zelt des Großwesirs für die Ausstellung im Bayerischen Armeemuseum errichtet wurde, kannst du dir in dem folgenden Video anschauen: Hast du ein gutes Auge für Details? Dann versuche, beim folgenden Memo-Spiel die Nahaufnahmen des Zeltes einander richtig zuzuordnen. Information zu MuseumDas Bayerische Armeemuseum ist eines der großen militärhistorischen Museen in Europa. Es besteht heute aus drei Häusern in Ingolstadt (Neues Schloss, Museum des Ersten Weltkriegs, Bayerisches Polizeimuseum). Abbildungsnachweis Titelbild: Das Zelt des Großwesirs (Ausstellungsraum im Museum). © Bayerisches Armeemuseum, Foto: Erich Reisinger, Grafik: malyma Werbung Neumarkt
„Rettet die Zärtlichkeit“ Eine kahle Betonwand. Es regnet. Am Bildrand steht ein Mann mit Regenschirm. In Sprühschrift der Schriftzug „Rettet die Zärtlichkeit“. Was könnte der/die Sprayer*in damals gemeint haben? Wie wirkt das Foto aus dem Jahr 1982 auf dich? Ist der Schriftzug auch heute noch oder wieder aktuell? Bleibt die Zärtlichkeit – in diesen Zeiten der geforderten körperlichen Distanz und der Isolation von vielen Menschen – auf der Strecke? Wofür lohnt es sich die Zärtlichkeit zu retten? Braucht es sie umso mehr in dieser angespannten Zeit? In den 1980er Jahren wurden Sprühdosen als Schreibwerkzeug und Gestaltungsmittel für den öffentlichen Raum zunehmend beliebter. Die Sicherheitsbehörden reagierten hart - bereits der Besitz von Dosen machte Jugendliche verdächtig. Doch die Durchsetzungskraft war nicht mehr aufzuhalten. In dem kurzen Video der Münchner Stadtbibliothek blickt der Theaterautor Jan Geiger auf die Zärtlichkeit. Eine weitere Sprühschrift aus den 80er Jahren hat bis heute auch nichts von ihrer Aktualität verloren: Volker Derlath, Sprüherei Alabama-Gelände 1986. © Volker Derlath Standen damals das Waldsterben, die Schwefeldioxidbelastung und die Anti-Atomkraft-Bewegung im Fokus, so ist heute der zu stoppende Klimawandel das globale Anliegen. Volker Derlath, Aktion gegen die Volkszählung in München 1986. © Volker Derlath Die Volkszählung von 1986, die die Einwohner*innen Deutschlands verpflichtete, eine Vielzahl persönlicher Daten preiszugeben, sorgte bundesweit für Besorgnis! Der Datenschutz war in Gefahr – heute wieder ein hochsensibles Thema, das sich lediglich auf andere Gebiete verlagert hat. Auch Künstler*innen hinterlassen Botschaften im öffentlichen Raum. Fällt dir jemand ein? Keith Haring, Untitled (Subway Drawing), 1983, Udo und Anette Brandhorst Sammlung, Foto: Haydar Koyupinar, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München, Keith Haring artwork © Keith Haring Foundation Nur durch Umrisslinien definierte Wesen, ohne Gesicht, Geschlecht oder Kleidung, in Bewegung, tanzend? Zwei umrahmte Szenen, übereinander, dazwischen eine Art Laufband mit einem wiederkehrenden Motiv … Diesmal bleiben wir – beim „Sprung“ ins Museum Brandhorst – in den 80er Jahren! Wie kommt ein Künstler darauf, seine Zeichnungen im öffentlichen Raum festzuhalten? „Für mich besteht kein Unterschied zwischen einer Zeichnung, die ich in der U-Bahn mache, oder einer, die für Tausende von Dollar in einer Galerie verkauft wird. Es gibt eindeutige Unterschiede im Kontext und im Medium, aber die Intention ist dieselbe.“ (Keith Haring) Bist du derselben Meinung? KEITH HARING (1958-1990) wollte mit den Menschen kommunizieren und nutzte den öffentlichen Raum als Galerie. Eines Tages entdeckte er in der New Yorker U-Bahn leere schwarze Flächen für Werbeplakate – ein idealer Ort, um seine Botschaften mit allen Menschen zu teilen, sie für alle zugänglich zu machen. Dieser demokratische Ansatz war ihm sehr wichtig, denn Kunst sei für jeden da! „Wie kaum ein anderer schaffte er es, die Brücke zu schlagen zwischen Kunstszene und Subkultur, zwischen breitem Publikum und Expertinnen und Experten.“ (Museum Brandhorst) Meist ohne abzusetzen, schuf er Zeichnungen in einer ganz eigenen wiedererkennbaren Bild- und Symbolsprache, einer universalen Sprache – über kulturelle und soziale Grenzen hinweg. Zudem gab er diesen Werken keine Titel, um eine Vielfalt an Deutungen zuzulassen, nach dem Motto: "Schau selbst, mach dir deine eigenen Gedanken!" „Die Wirklichkeit der Kunst beginnt in den Augen des Betrachters und erlangt Kraft durch Fantasie, Erfindungsgabe und Konfrontation.“ (Keith Haring) Schnell oder langsam? Da es natürlich nicht erlaubt ist, Flächen im öffentlichen Raum zu „beschmieren“, war Keith Haring gezwungen, zügig zu malen. Trotzdem wurde er mehrmals festgenommen und sogar in Handschellen abgeführt. Aber das schnelle Arbeiten entsprach sicherlich auch seinem Wesen. Manchmal entstanden pro Tag bis zu 40 dieser U-Bahn-Zeichnungen. Faszinierend, ihm zuzusehen! Vielleicht findest du hierzu ein Video im Netz! Schau mal z. B. HIER. Keith Haring, Untitled (Subway Drawing), 1983, Kreide auf Papier, Original U-Bahn-Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Udo und Anette Brandhorst Sammlung, Foto: Haydar Koyupinar, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München, Keith Haring artwork © Keith Haring Foundation „The man who wasn´t there“ – ziemlich passend, oder? Ob sich Haring ganz bewusst den Platz neben diesem Kinoplakat ausgesucht hat? Als eine Art „Ghostartist“? Und womit … „Da sie so empfindlich waren, rührten die Leute sie nicht an, sie respektierten sie; sie radierten sie nicht weg oder zerstörten sie. Das verlieh ihnen diese ganz eigene Kraft. Es war dieses kreideweiße, fragile Etwas inmitten all dieser Kraft und Spannung und Gewalt, die von der Subway ausgeht.“ (Keith Haring) Experimentiere selbst mit verschiedenen Malwerkzeugen und Materialien: Kreide, Bleistift, Farbstift, Edding, flüssige Farbe …, weiß auf schwarz, schwarz auf weiß, einfarbig, bunt, zart, fett, auf Papier, Pappe, Holz, Kunststoff … Wie verändert sich die Wirkung? Was macht seine Bildsprache so einzigartig und unverwechselbar? © Museumspädagogisches Zentrum Schau selbst: Die fortlaufenden Linien, die Rahmen, die Bewegungsstriche, die wiederkehrenden Motive wie krabbelnde Babys, geschlechtslose, interagierende, tanzende Menschen …? Für was könnten sie stehen? Keith Haring – ein politischer Aktivist Seine Bildsprache wirkt auf den ersten Blick unbekümmert und fröhlich. Tatsächlich war er aber ein durch und durch politischer Mensch, der sich in seinem Schaffen für die Menschen und ihre Umwelt und gegen jede Art von Ungerechtigkeit, Ausgrenzung und Diskriminierung einsetzte; ein politischer Aktivist, der sich für den Frieden und ein tolerantes Miteinander engagierte: Botschaften aktueller denn je? Mehr hierzu im nächsten Beitrag zu POP PUNK POLITIK! Botschaften im öffentlichen Raum Es gibt es viele: Sprühschriften, Graffitis, Statements, freihändig oder mit Schablonen gesprüht, oder einfach nur diverse Aufkleber. Welche Botschaften entdeckst du im öffentlichen Raum? Bilder: Aktuelle Botschaften im öffentlichen Raum © Katharina Schweigart, Bearbeitung Gif: Museumspädagogisches Zentrum Und was empört dich? Worauf möchtest du die Menschen aufmerksam machen? Welche Botschaften möchtest du mit der Welt teilen? Denke dir ein eigenes Meme aus und teile es mit uns auf Instagram oder Facebook und verwende den Hashtag #PopPunkPolitik! Deine Meinung? Teile sie gerne mit uns auf Instagram oder Facebook und verwende den Hashtag #PopPunkPolitik! Alle Beiträge zu der Reihe PopPunkPolitik findet ihr HIER. Und Lust auf ACTION?Kreative Anregungen zum Denken, Diskutieren und kreativen Gestalten findest du auf unseren ActioncARTS, eine Kooperation mit dem Museum Brandhorst:Ohne Worte kommunizieren (deutsch / englisch)Urban und öffentlich (deutsch / englisch) Passender Beitrag auf Xponat Ohne Worte kommunizieren Passende MPZ-Führung„Food for the mind“ – sehen, denken, diskutieren (MS ab Jgst. 8, RS ab Jgst. 8, GYM ab Jgst. 8,BS)Kunst und Kommunikation (RS ab Jgst. 9, GYM ab Jgst. 9)Mittelschulprogramm: Was macht zeitgenössische Kunst … und was hat das mit mir zu tun? (MS)Vielfalt entdecken – Die (Kunst-)Welt ist bunt! Mit dem MPZ gegen Fremdenfeindlichkeit! (MS; RS, FöS, GS ab Jgst. 3, GYM, Horte, Inklusionsklassen, BS) Informationen zu den MuseenWeitere „Botschaften“ aus dem öffentlichen Raum findest Du im Museum Brandhorst und seiner einzigartigen Sammlung von Kunstwerken ab Ende der 50er Jahre bis heute sowie in der Ausstellung #PopPunkPolitik der Monacensia im Hildebrandhaus, dem literarischen Gedächtnis der Stadt München. Die Artikel-Serie zu #PopPunkPolitik verlängert die Ausstellung in den digitalen Raum hinein und vertieft Themen der 1980er Jahre aus literarischer und heutiger Perspektive. Abbildungsnachweis Titelbild: Plakatmotiv zu Pop Punk Politik – die 1980er Jahre in München (Ausschnitt). © Monacensia im Hildebrandhaus und Volker Derlath, Rettet die Zärtlichkeit (Ausschnitt). © Volker Derlath
Pia und Ulrich schauen sich eine Darstellung des berühmten Herrschers Julius Caesar ganz genau an und entschlüsseln eine über 2000 Jahre alte Münze, die er in Auftrag gegeben hat. Dabei wird klar: Macht wird mithilfe von Bildern demonstriert und gefestigt. Und die Römer nutzten dafür schon damals Methoden, die auch heute noch eingesetzt werden.Ganz nebenbei ist eine merkwürdige Trompete zu hören – und das Geheimnis um die Kaisersemmel wird natürlich auch gelüftet. Der Film ist der Auftakt zur Reihe „Antike in Gold und Gips“ – eine Kooperation des Museums für Abgüsse Klassischer Bildwerke, der Staatlichen Münzsammlung München und des Museumspädagogischen Zentrums. Die großen, beeindruckenden Statuen des Museums für Abgüsse Klassischer Bildwerke ergänzen perfekt die feinen, aussagekräftigen Münzbilder der Staatlichen Münzsammlung. Das Museumspädagogische Zentrum garantiert mit seiner langjährigen museumspädagogischen Erfahrung und Kompetenz für eine zielgruppenorientierte Umsetzung des Themas. Passender Beitrag auf XponatBüste, Münze Passende MPZ-Online-Veranstaltung MusPad: Antike Porträts und ihre Botschaften (MS ab Jgst. 8, RS ab Jgst. 8, GYM ab Jgst. 8) Passende MPZ-Online-MaterialienCaesar, der Elefant und der Bürgerkrieg (MS ab Jgst. 6, RS ab Jgst. 6, GYM ab Jgst. 6, BS) Passende MPZ-Führung Porträts der Mächtigen – die Selbstdarstellung römischer Herrscher (MS, RS, GYM) Informationen zu den Museen Das Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke zeigt originalgetreu abgeformte Skulpturen der griechischen und römischen Antike vom 7. Jahrhundert vor Christus bis zum 5. Jahrhundert nach Christus. Die Münzsammlung liegt in der Residenz. Dort finden wir alles was mit Geld zu tun hat, Münzen, Geldscheine, Kreditkarten und auch Medaillen aus den letzten 2600 Jahren. Abbildungsnachweis Titelbild: Ausschnitt aus dem Film „Caesar und die Macht der Bilder“. © Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke, Staatliche Münzsammlung und Museumspädagogisches Zentrum, Film: Matthias Ring
Schon gewusst ...? Edel-Punks auf dem Münchner Marienplatz, 1984 (Ausschnitt). © Volker Derlath Und wie war es als Punk? Cornelia Siebeck, ehemalige Punkerin, beschreibt das Lebensgefühl der Münchner Punks damals: Zitat: Cornelia Siebeck, aus einem Interview mit Ralf Homann, Kurator der Ausstellung Pop Punk Politik in der Monacensia im Hildebrandhaus. © Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum Aussehen, Lebensstil und Kleidung sind für Punks Ausdruck von Provokation und Protest.Welche Stilmittel benutzen sie, um sich äußerlich abzugrenzen? Rabe Perplexum? „Selbstportrait“ mit Kreditkarte. © Rainer Schwinge; Edel-Punks auf dem Münchner Marienplatz, 1984 und Mercedes-Stern. © Volker Derlath Widerstand kann sich also über Kleidung und Schmuck ausdrücken. Die als Ohrring umfunktionierte Kreditkarte versteht sich als Kapitalismuskritik. Jacken, häufig aus Leder und mit Nieten besetzt, werden zum Medium unterschiedlicher, auch politischer Botschaften – wie hier gegen Nazis und die Politik des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl. Wir wagen den Sprung vom Jahr 1986 ... Punks auf dem Münchner Marienplatz 1984 (Ausschnitt). © Volker Derlath ... ins Jahr 2006 Seth Price, Vintage Bomber, 2006, Vakuumgeformtes Polystyrol (Ausschnitt), 123,2 x 92,7 x 6,4 cm, Udo und Anette Brandhorst Sammlung, Foto: Ron Amstutz, Courtesy of the artist Euer erster Gedanke?Was ist hier gleich? Und was ist anders? Der Fotograf Volker Derlath hält die Kamera auf die Lederjacke und fokussiert die Botschaften. Seth Price inszeniert eine Bomberjacke als Kunstwerk.Das Foto zeigt uninszeniert die auf der Lederjacke individuell hinterlassenen Botschaften durch Schrift.Und hier: Die Botschaft befindet sich nicht auf, sondern in der Kleidung? „Mich interessieren die in Kleidung enthaltenen Codes.“ (Seth Price, 2020) Der Multimediakünstler Seth Price beschäftigt sich mit der Zeichenhaftigkeit unserer Kleidung, und wie sie sich im Laufe der Zeit verändern kann. Welche Kleidungsstücke fallen dir noch ein, die mit einer Botschaft, einer Zugehörigkeit besetzt sind?Haben sich ihre „Codes“ im Laufe der Zeit verändert? High Heels von Caitlyn Wilson, Basballcap von NATHAN MULLET, Handtasche von Laura Chouette auf www.unsplash.com; Hoodie auf www.pixabay.com; Frau mit Tuch von Jean-François Gornet - Flickr: Voile, CC BY-SA 2.0; Bearbeitung: GIF Museumspädagogisches Zentrum Möchten auch wir mit unserer Kleidung etwas ausdrücken, eine Botschaft übermitteln? Möchten wir herausstechen und uns abgrenzen? Oder in der Masse untergehen? Oder zu einer bestimmten Gruppe dazugehören? Wie sehr identifizieren wir uns mit Kleidung? Welche soziale Funktion hat sie? Kann man sich neutral kleiden? Weiblich, männlich, queer? Ist Kleidung Integration? Kommunikation? Inszenierung? Haltung? Protest? Provokation? Kult? Status? … Und ab wann ist sie politisch? Eine Bomberjacke, wie zufällig hingeworfen und „eingefroren“ Tatsächlich handelt es sich beim "Vintage Bomber" um eine komplizierte Technik, bei der die Jacke in goldfarbenem Plastik abgeformt und zuvor vorbereitet und ausgestopft wurde – ähnlich dem Vakuumverfahren bei industriellen Verpackungen, z.B. bei Pralinen.Seth Price nennt die so entstandenen Arbeiten „Vacuum“-Skulpturen.Vakuum, d.h. leer, da letztlich nur die Form, der Abguss bleibt, wie bei einer „Totenmaske“ (Achim Hochdörfer, Direktor des Museums Brandhorst). Leer also vielleicht auch, weil der Mensch, der Inhalt fehlt: Wo bleibt das Individuum hinter Kommerz und Mainstream-Mode?Und was bewirkt die goldene Farbe? Was assoziierst du mit Gold? Alle Bilder auf www.pixabay.com / unsplash.com Das Kunstwerk wirkt wie eine der Ikonen unserer modernen Welt: Produkte von Kommerz und Konsum, die alles dominieren – eine Kritik, die bereits in den 1980er Jahren zu hören war.Vielleicht lässt das Gold aber auch „[…] an den wahnsinnigen Kunstmarkt denken, der zu Beginn der 2000er Jahre gerade explodierte, was übrig blieb, war das begehrenswerte Konsumgut, der reine Warenfetisch“ (Achim Hochdörfer, Direktor des Museums Brandhorst).Aber wie wirkt es auf dich, schau dir den "Vintage Bomber" unbedingt unmittelbar im Museum Brandhorst an. Du kannst auch mit deiner Handykamera diesen Code scannen! Klicke HIER oder nutze den QR-Code und gib deine Antworten ein. Lade anschließend die Website neu. Ausblick: Kann aus weniger mehr werden?Wünscht ihr euch, dass unsere „Hülle“ zukünftig vielleicht keine so große Rolle mehr spielt und wir uns mehr durch unser Handeln auszeichnen, mit diesem identifizieren und stärker hinter die „Hüllen“ blicken? Vielleicht bringen der Klimawandel und der daraus notwendig werdende Verzicht, auch auf Fast Fashion, uns hier ja ein Stück weiter – eben „Vintage“ in future. Deine Meinung? Teile sie gerne mit uns auf Instagram oder Facebook und verwende den Hashtag #PopPunkPolitik! Alle Beiträge zu der Reihe PopPunkPolitik findet ihr HIER. Möchtest du weitere Informationen zu Pop.Punk.Politik und mitdiskutieren, dann gehe auf den gleichnamigen Blog der Münchner Stadtbibliothek oder #PopPunkPolitikUnd Lust auf ACTION?Kreative Anregungen zum zwei- und dreidimensionalen Gestalten oder zum Upcyceln findest du auf unseren ActioncARTs, eine Kooperation mit dem Museum Brandhorst: Dress up – nur Kleidung oder mehr? (deutsch /englisch)Ein spannendes Gespräch zum Vintage Bomber zwischen Katja Eichinger und der ehemaligen leitenden Kuratorin des Museums Patrizia Dander findest du HIER. Passende MPZ-Führung„Food for the mind“ – sehen, denken, diskutieren (MS ab Jgst. 8, RS ab Jgst. 8, GYM ab Jgst. 8,BS)Kunst ist politisch (MS, RS, GS ab Jgst. 3, GYM, Horte, BS)Kunst und Kommunikation (RS ab Jgst. 9, GYM ab Jgst. 9) Informationen zum MuseumDie Monacensia im Hildebrandhaus ist das literarische Gedächtnis der Stadt München. Neben dem Literaturarchiv der Stadt München ist hier eine Forschungsbibliothek zur Geschichte und zum kulturellen Leben Münchens untergebracht. Im Museum Brandhorst, einem Museum für Gegenwartskunst im Kunstareal, kannst du viele weitere spannende Kunstwerke entdecken. Schau unbedingt vorbei! Abbildungsnachweis Titelbild: Plakatmotiv zu Pop Punk Politik – die 1980er Jahre in München (Ausschnitt). © Monacensia im Hildebrandhaus und Edel-Punks auf dem Münchner Marienplatz, 1984. © Volker Derlath
Machst du eine Reise in den Ferien? Wohin reist du? Mit welchem Verkehrsmittel kommst du zu deinem Ziel? Wo startest du? Finde das passende Wort im Koffer und ergänze die Sätze. Du planst mit einer Freundin oder einem Freund eine Reise in den nächsten Ferien. Ihr unterhaltet euch. Ziehe das passende Verb in die Lücke. Und hier die konjungierten Verben noch einmal zum Nachlesen: Reist, reisen, fährst, fahren, sitze, sitzt, gehe, Gehst, freue, Freust Nachhaltigkeit 17ziele.de Qualität in der Bildung (Ziel 4) ist eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen! Eine Sprache zu beherrschen, ermöglicht Teilhabe an Bildungsangeboten. Das MPZ bietet daher verschiedene Programme in Museen an, die das Erlernen der deutschen Sprache unterstützen, Gesprächsanlässe bieten und Wortschatz und Sprachgewandtheit fördern. Passende MPZ-FührungenUnterwegs in der Stadt (Deutschklasse GS, Deutschklasse MS Jgst. 5-6, Deutschklasse MS Jgst. 7-9, BIJ, BIK, BS, BVJ, DK BS) Informationen zu den MuseenWenn du mehr über die vielen Verkehrsmittel erfahren möchtest, dann besuche das Deutsche Museum. Das Deutsche Museum hat in München drei Standorte. Auf der Museumsinsel findest du Schiffe, im Verkehrszentrum Autos, Züge, Fahrräder, Kutschen und viel mehr. Flugzeuge kannst du in der Flugwerft in Unterschleißheim bewundern. Abbildungsnachweis Titelbild: Sprachreihe – Reisen. © Grafik: Fabian Hofmann

Die Figur im Puzzle zeigt die Göttin des Friedens, Eirene. Sie trägt ein Baby auf dem Arm. Setze die Ausschnitte richtig zusammen. Findest du die richtigen Körperteile? Ordne sie zu! Und hier die Namen der Körperteile noch mal zum Nachlesen:der Kopf, der Ellbogen, der Fuß, der Rücken, der Bauch, das Knie, die Haare, die Brust, der Hals Das waren Körperteile. Jetzt schauen wir uns das Gesicht an. Schiebe die Begriffe an die richtigen Stellen. Und hier die Namen für die Teile des Gesichts noch mal zum Nachlesen: der Bart, die Haare, das Kinn, der Mund, das linke Auge, das rechte Auge, die Nase, das linke Ohr, das rechte Ohr, die Stirn O je, hier ist einiges durcheinander geraten. Du kannst die Köpfe so zusammensetzen wie auf den Bildern, aber auch eigene neue Köpfe gestalten. Passender Beitrag auf XponatStatue, Porträt, Ganzfiguriges Porträt, BüstePassende MPZ-FührungProgramm für Deutschklassen: Von Kopf bis Fuß (Deutschklasse MS Jgst. 5-6, Deutschklasse MS Jgst. 7-9, DK BS, Deutschklasse GS) Informationen zum MuseumAlle Figuren dieses Beitrags findest du in der Glyptothek am Königsplatz in München. Das Museum ist in der ganzen Welt berühmt. Warum? Dort siehst du ganz besondere antike Ausstellungsstücke aus Griechenland und Rom. Alle sind aus Marmor. Und: Es ist das älteste öffentliche Museum in München. Abbildungsnachweis Titelbild: Sprachreihe – Körperteile. © Grafik: Fabian Hofmann
Am Morgen geht die Sonne auf. Am Mittag steht die Sonne hoch am Himmel. Es kann heiß werden. Dann kann man sogar im See baden. Am Abend wird es dunkel. Und wie ist es nachts? „In der Nacht sind alle Katzen grau“, sagt man auf Deutsch. Willst du mehr über die Bilder wissen?Dann klicke unter dem Spiel links auf den Button rights of use: Jetzt siehst du jedes Bild einzeln und kannst erfahren, wie es heißt und wer es gemalt hat. Und hier nochmal zum Wiederholen – lies laut:der Morgen, der Abend, der Tag, der Mittag, die Nacht, die Sonne, der Mond, die Sterne Sammle deine eigenen Sprichwörter Kennst du Sprichwörter aus deiner Heimat? Schreibe sie in deiner Sprache auf einzelne Karten. Übersetze sie auf der Rückseite ins Deutsche und hefte sie in dein MPZ-Album. NACHHALTIGKEIT Qualität in der Bildung (Ziel 4) ist eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen! Eine Sprache zu beherrschen, ermöglicht Teilhabe an Bildungsangeboten. Das MPZ bietet daher verschiedene Programme in Museen an, die das Erlernen der deutschen Sprache unterstützen, Gesprächsanlässe bieten und Wortschatz und Sprachgewandtheit fördern. Passende MPZ-FührungProgramm für Deutschklassen: Im Laufe des Tages … (Deutschklassen, GS, MS, BS) Informationen zum MuseumDie hier gezeigten Gemälde findest du in der Sammlung Schack, du kannst das Museum auch in einem kleinen Film kennenlernen. Abbildungsnachweis Titelbild: Sprachreihe – Tageszeiten. © Grafik: Fabian Hofmann
Im Deutschen kann man zu zwei ähnlichen Menschen sagen: „Sie sind aus dem gleichen Holz geschnitzt.“ Finde immer zwei Gegenstände, die aus dem gleichen Material gemacht sind, und höre dir an, wie das Material die Gegenstände beschreibt: gläserne Flaschen, Stuhl aus Holz, silberne Teekanne und vieles mehr. Mit den gezeigten Objekten aus der Pinakothek der Moderne und aus dem Bayerischen Nationalmuseum kannst du die Wörter für Material auf Deutsch hören und üben. Willst du mehr über die Bilder wissen? Dann klicke unter dem Spiel links auf rights of use: Jetzt siehst du einige Bilder mit Link. Klicke auf den Link und erfahre mehr. Und hier die Namen der Materialien noch mal zum Nachlesen:Holz, Kunststoff, Plastik, Glas, Stoff, Gold, Silber, Metall, Eisen Sammle deine eigenen Materialien!Wenn du Lust hast, nimm ein festes Papier oder einen Karton und klebe Dinge aus verschiedenen Materialien wie Büroklammer, Gummiband oder Kaugummipapier darauf. Dann schreibe zu den einzelnen Dingen, aus welchen Materialien sie bestehen. Anschließend kannst du das Blatt in dein MPZ-Album heften. Passendes MusPadMöbel – Muster – Material Passende MPZ-FührungenProgramm für Deutschklassen: Stühle, Sessel, Teller, Tassen – besondere Dinge im Designmuseum (Deutschklasse GS, Deutschklasse MS Jgst. 5–6, Deutschklasse MS Jgst. 7–9, BIJ, BIK, BS, BVJ, DK BS) Informationen zu den MuseenDie Dinge aus dem Spiel findest du in diesen Museen: Bayerischen Nationalmuseum, Die Neue Sammlung – The Design Museum und Pinakothek der Moderne. Vielleicht kannst du sie bei einem Besuch oder einem digitalen Rundgang wiederentdecken. Abbildungsnachweis Titelbild: Sprachreihe – Material. © Grafik: Fabian Hofmann

Kariert, gestreift, geblümt, getigert … Im Deutschen gibt es gar nicht so viele Adjektive, die Muster beschreiben. Manchmal umschreiben wir die Muster deshalb auch: ein Muster mit Schlangenlinien, ein Muster aus Tupfen… Mach dich auf die Suche nach Mustern in Kunstwerken – auf gemalten Stoffen, Tierfellen oder auf einem Krug! Höre genau hin und suche die richtigen Paare.Willst du mehr über die Bilder wissen? Dann klicke unter dem Spiel links auf rights of use: Jetzt siehst du jedes Bild einzeln und kannst erfahren, in welchem Museum es hängt, wie es heißt und wer es gemalt hat. Und hier noch mal zum Wiederholen – lies laut:Gestreift, gepunktet, getupft, getigert, kariert, geblümt, gefleckt, einfarbig und uni. Jetzt bist du dran:Male verschiedene Muster auf einzelne Karten und gib ihnen Namen. Lege dir eine Muster-Wörter-Sammlung an, die du anschließend in dein MPZ-Album heften kannst. Musterideen dazu findest du in den Kunstmuseen, in Online-Sammlungen, Katalogen … Passender Beitrag auf XponatMemo-Spiel Passendes MusPadMöbel – Muster – Material Passende MPZ-FührungProgramm für Deutschklassen: Stühle, Sessel, Teller, Tassen - besondere Dinge im Designmuseum (Deutschklasse GS, Deutschklasse MS Jgst. 5-6, Deutschklasse MS Jgst. 7-9, BIJ, BIK, BS, BVJ, DK BS) Informationen zu den MuseenDie hier gezeigten Bilder kommen aus der Neuen Pinakothek und der Städtischen Galerie im Lenbachhaus. Die meisten sind gerade im Depot und werden nicht ausgestellt. In den Online-Sammlungen des Lenbachhauses und der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen kannst du alle anschauen. Abbildungsnachweis Titelbild: Sprachreihe – Muster. © Grafik: Fabian Hofmann
Welche Künstlerinnen kennst du?Die Kunstgeschichte ist überwiegend weiß und männlich. Dies soll sich ändern und zunehmend werden Künstlerinnen in Museen, Galerien und auf dem Kunstmarkt sichtbar – wenn auch noch immer unterrepräsentiert und schlechter bezahlt! Das Museum Brandhorst hat in den vergangenen Jahren bedeutenden Künstlerinnen Einzelausstellungen gewidmet – wie der Bildhauerin Alexandra Bircken die große Werkschau: „Alexandra Bircken: A–Z”. Alexandra Bircken im Museum Brandhorst. © Foto: Haydar Koyupinar, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Museum Brandhorst, München Alexandra Bircken, Cagey, 2012, Äste, Weiden, Holz, Stoff, Daunenjacke, Mörtel, Wolle, Stroh, Seil, Wärmedecke, Bronze, Rollen, Schrauben, Backsteine, 230 x 170 x 170 cm. © Alexandra Bircken. Foto: Fred Dott, Hamburg, Courtesy BQ, Berlin und Herald St, London Alexandra Bircken The Doctor, 2020, Schaufensterpuppe, Stoff, Wattierung, Faden, Metall, Beinprothese, Baumstamm, Modellboot, Metallständer 183 × 62 × 60 cm. © Alexandra Bircken. Foto: Andy Keate, Courtesy die Künstlerin, BQ, Berlin and Herald St, London „… mit der Welt der Materialien bin ich noch lange nicht fertig.“ A. Bircken Alexandra Bircken arbeitet mit verschiedensten Materialien wie Baustoff, Bronze, Chrom, Haaren, Holz, Knochen, Messing, Nylon, Leder, Stahl, Stoffen, Wolle. Sie interessiert sich für ihre Oberflächen, für „ihre Bedeutung und Reaktion zueinander“ (Zit. nach: Tanja Beuthien: Bis ins Mark, in: ART - das Kunstmagazin, August 2021, S. 45): Wie fühlen sie sich an? Was lösen sie in uns aus?Auch nutzt die Künstlerin Gegenstände, die ihr im Alltag begegnen: Autos, Motorräder, OP-Hemden, Schaukelpferde, Skier. Allerdings löst sie diese aus den uns vertrauten Zusammenhängen und überrascht uns durch ungewöhnliche Kombinationen. „… weil man in der Kunst mit ganz wenig etwas machen kann.“ A. Bircken Ursprünglich war sie – nicht Chirurgin – eine erfolgreiche Mode-Designerin, in London, Paris und Köln. „Alex“ nannte sie ihr Kölner Atelier, in dem sich die entstandenen Objekte allmählich vom Körper lösten und an der Wand und auf dem Boden funktionslos verselbständigten. Wie würdest du dein Atelier nennen? Amira, Anna, Fabio, Georg? „Mode … hat natürlich viel mehr … Zwänge … Man kann nichts verkaufen, wo jemand hässlich drin aussieht. Man kann aber Kunst machen, die die Sachen ein bisschen pusht, um einfach auch etwas zu provozieren." A. Bircken Darf Kunst provozieren, irritieren, uns vor den Kopf stoßen und so zum Nachdenken anregen? Und ab wann ist ein Produkt Kunst – und nicht mehr Mode?Auch als sich Alexandra Bircken von der Modewelt abwendet, bleiben der menschliche Körper, Haut und Hülle sowie Textilien wichtig in ihrem Schaffen:Wie schützen wir uns? Welche Häute und Hüllen trennen uns von unserer Umgebung und welche Aufgaben erfüllt unsere „zweite Haut“? Nur Schutz, oder auch Identität …?Mehr hierzu: „Unsere zweite Haut“. Key Visual „Alexandra Bircken: A–Z“. © Museum Brandhorst, Design: PARAT.cc, Bearbeitung: GIF Museumspädagogisches Zentrum Außerdem nutzt die Künstlerin die erlernten Techniken, das Schneiden und Verbinden, Nähen, Knoten, Stricken, Häkeln auch für die vielfältige Formensprache ihrer Skulpturen. Manchmal braucht sie allerdings auch die Hilfe von Assistent*innen oder Maschinen.Was glaubst du, bei welchem Werk zum Beispiel?Tatsächlich wollte sie anfangs Chirurgin werden. Ihr Jargon, d.h. ihre (Formen-)Sprache als Künstlerin, leitet sich aber nicht allein vom Menschen ab, sondern auch von der Maschine und ihrer gegenseitigen Beziehung:„Der Mensch funktioniert teilweise wie eine Maschine.“ A. Bircken (Zit. nach: Alexandra Bircken. A-Z. Begleitheft zur Ausstellung, München 2021, S. 1). Funktioniert das Motorrad auch ohne den Menschen?Nähere dich dem Motorrad. Alexandra Bircken, RSV 4 (Detail), 2020, Motorrad, Stahl, 2 Teile: Front: 117 × 112 × 77 cm, Heck: 100 × 103 × 57 cm. © Alexandra Bircken. Foto: Roman März, Berlin, Courtesy die Künstlerin, BQ, Berlin und Herald St, London, Bearbeitung: GIF Museumspädagogisches Zentrum Kannst du Ähnlichkeiten mit dem menschlichen Körper entdecken?Lass dich überraschen! Alexandra Bircken, Slip of the Tongue, 2020, Aluminium, Edelstahl, Stahl, Beton, Lack. © Alexandra Bircken. Foto: Haydar Koyupinar, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Museum Brandhorst, München Organe wie eine Riesenzunge, eine aufblasbare und leuchtende Riesenlunge oder eine echte Plazenta! Sie stammt aus der Schwangerschaft ihrer 2011 geborenen zweiten Tochter und ist die Antwort auf Gustave Courbets berühmtes Gemälde „Der Ursprung der Welt“ (1866), aber eben aus weiblicher Sicht, als Mutter und Künstlerin in einer Person.Kunstwerke quer auf dem Boden, an der Wand, viele Raster, oder mitten im Raum – die Objekte selbst aber oft in vollkommener Symmetrie!Stets laden sie uns ein, genau hinzusehen, zu rätseln oder zu lachen:Humor und Ironie sind ihr sehr wichtig, im Leben und in ihrer Arbeit. Das sieht man zum Teil auch an den Titeln:"Das sind … manchmal so kleine Entscheidungen, die man noch fällt, bevor eine Arbeit fertig ist. Um noch einmal irgendwas in eine andere Richtung zu schubsen. Oft sind es auch die Titel, die einfach noch einmal etwas Anderes andeuten, anreißen. Die Titel finde ich wahnsinnig wichtig." A. Bircken (Zit. nach: Alexandra Bircken. A-Z. Begleitheft zur Ausstellung, S. 1). Jetzt bist du gefragt! Finde den Titel zum Kunstwerk! Schau genau …Alexandra Bircken beobachtet ihre Umwelt genau:„Sie arbeitet mit allem, was den Menschen ganz unmittelbar umgibt, sei es Stoff, Kleidung, Architektur oder Raum“ (zit. nach: Tanja Beuthien: Bis ins Mark, in: ART - das Kunstmagazin, August 2021, S. 45), so die Kuratorin der Ausstellung:„Mich beschäftigt unsere unmittelbare Umgebung. Die Architektur, in der wir uns bewegen, genauso wie die Stoffe, in die wir uns hüllen. Letztlich kommt man dabei immer wieder auf den Schutz und gleichzeitig auf die Verletzbarkeit unseres Körpers zurück. Auch unsere Haut ist eine Hülle und zugleich die Schnittstelle zwischen innen und außen. Hier setze ich an.“ A. Bircken (Zit. nach: Alexandra Bircken. A-Z. Begleitheft zur Ausstellung, München 2021, S. 1). Kannst du ihren Gedanken folgen? Was beschäftigt dich? Alexandra, Ex, Cagey, New Model Army, Snoopy …Erstelle dein eigenes ABC-Darium zu deiner Begegnung mit Alexandra Bircken: Titel, Themen, Assoziationen oder Materialien … – teile es mit uns auf Instagram oder Facebook!Verrate uns noch dein Lieblingswerk: Die Riesen-Zunge, das zweigeteilte Motorrad? Oder eher der rätselhafte „The Doctor“? Nachhaltigkeit Die Geschlechtergerechtigkeit ist eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen! (Ziel 5). Lust auf ACTION?Kreative Anregungen zum zwei- und dreidimensionalen Gestalten oder zum Upcyceln findest du auf unseren ActioncARTS, eine Kooperation mit dem Museum Brandhorst: Unsere zweite Haut I (deutsch/englisch), II (deutsch/englisch), III (deutsch/englisch). Passender Beitrag auf XponatUnsere zweite Haut Informationen zum Museum Im Museum Brandhorst, dem Museum für Gegenwartskunst im Kunstareal, gibt es im Erd- und Obergeschoss noch viele weitere Künstler*innen zu entdecken. Schau unbedingt vorbei, auch digital. Abbildungsnachweis Titelbild: Alexandra Bircken im Museum Brandhorst. © Foto: Haydar Koyupinar, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Museum Brandhorst, München
Du kannst auch mit deiner Handykamera diesen Code scannen! Klicke HIER oder nutze den QR-Code und gib deine Antworten ein. Lade anschließend die Website neu. Pop war in den 1980er Jahren weit mehr als Mainstream-Musik und Punk mehr als grell gefärbte Irokesenfrisuren. Pop und die damit verbundene Jugendkultur verstand sich als unpolitischer, eher angepasster Gegenentwurf in politisch unruhigen Zeiten. Im Gegensatz dazu standen die eher auf Konfrontation ausgerichteten Punks, die allein schon durch ihre äußere Erscheinung und ihre Präsenz im Straßenbild provozierten. Wie „bunt“ Pop und Punk das gesellschaftliche Leben machten, das zeigte die Ausstellung „Pop Punk Politik – Die 1980er Jahre in München“ in der Monacensia im Hildebrandhaus.Die 80er Jahre waren ein Jahrzehnt vielfältiger Bewegungen und Gegenbewegungen zu einer „behaglichen“ bürgerlichen Welt und zu festgefahrenen politischen Ansichten. Sie waren eine Zeit gesellschaftlicher, politischer und sozialer Umbrüche. Diese hatten ihre Wurzeln oft schon in vorausgegangenen Jahrzehnten. Clara MacDonell, Mic Radio GIF, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum Das Eintreten für Frauenrechte, der Kampf für bezahlbaren Wohnraum oder gegen die Diskriminierung von Homosexuellen, gegen das Waldsterben, das Ozonloch und andere Gefahren durch Umweltzerstörungen, gegen das Wettrüsten der Supermächte und die atomare Bedrohung rückten damals ins Zentrum der öffentlichen Diskussion. Mit teils ungewöhnlichen Aktionen, Medien und Botschaften, die oft bewusst provozieren sollten, wurden Missstände offen beim Namen genannt. Das, was in den 80er Jahren angestoßen wurde, wirkt zum Teil bis heute nach. Vieles hat nach fast einem halben Jahrhundert gesellschaftliche Anerkennung gefunden. In vielerlei Hinsicht ist die Zeit der 80er Jahre mit der heutigen vergleichbar. Aus dem „no future“-Gefühl der jungen Generation entstanden neue Formen der Verweigerung, aber auch des offenen Protests, die eine ganz neue Dynamik gewannen.Die in den 70er und 80er Jahren immer deutlicher zutage tretenden Umweltschäden waren Anlass zur Gründung der „Grünen“. Heute engagieren sich viele Menschen für die Klimaschutzbewegung „Fridays for future“. Trat in den 80er Jahren Aids als neue gesundheitliche Bedrohung auf den Plan, so ist es aktuell Corona.Jedes Jahrzehnt reagiert mit Ideen, Bewegungen, Sub- und Jugendkulturen auf politische, gesellschaftliche, ökonomische und ökologische Herausforderungen oder Missstände. Damals wie heute stehen dieselben Fragen im Vordergrund: © Museumspädagogisches Zentrum Diesen und weiteren Fragen nach Kontinuität zwischen damals und heute, nach Vergleichbarkeit, Veränderung und Verbesserung wollen wir in den folgenden Monaten in einem kleinen Experiment auf MPZ-digital nachgehen. Zentrale Inhalte und Objekte der Ausstellung „Pop Punk Politik“ in der Monacensia im Hildebrandhaus sollen dabei zeitgenössischen Kunstwerken aus dem Museum Brandhorst gegenübergestellt werden und miteinander in Kommunikation treten.Ist Kleidung … Links : Punks auf dem Münchner Marienplatz 1984 (Ausschnitt). © Volker Derlath; Rechts: Seth Price, Vintage Bomber, 2006, Vakuumgeformtes Polystyrol, 123,2 x 92,7 x 6,4 cm, Udo und Anette Brandhorst Sammlung, Foto: Ron Amstutz, Courtesy of the artist; Bearbeitung: GIF Museumspädagogisches Zentrum Deine Meinung? Teile sie gerne mit uns auf Instagram oder Facebook und verwende den Hashtag #PopPunkPolitik! Alle Beiträge zu der Reihe PopPunkPolitik findet ihr HIER. Passende MPZ-Führung„Food for the mind“ – sehen, denken, diskutieren (MS ab Jgst. 8, RS ab Jgst. 8, GYM ab Jgst. 8,BS)Kunst ist politisch (MS, RS, GS ab Jgst. 3, GYM, Horte, BS)Kunst und Kommunikation (RS ab Jgst. 9, GYM ab Jgst. 9) Informationen zum MuseumDie Monacensia im Hildebrandhaus ist das literarische Gedächtnis der Stadt München. Neben dem Literaturarchiv der Stadt München ist hier eine Forschungsbibliothek zur Geschichte und zum kulturellen Leben Münchens untergebracht. Buchtipps zur damaligen Ausstellung „Pop, Punk, Politik“ findest du auf dem Blog der Münchner Stadtbibliothek, hier kannst du auch eigene Büchertitel im Kommentarfeld eingeben, die zum Thema passen.Im Museum Brandhorst, einem Museum für Gegenwartskunst im Kunstareal, kannst du viele weitere spannende Kunstwerke entdecken. Schau unbedingt vorbei, auch online! Es besitzt übrigens auch die europaweit größte Sammlung des Pop Art-Künstlers Andy Warhol. Abbildungsnachweis Titelbild: Plakatmotiv zu Pop Punk Politik – die 1980er Jahre in München (Ausschnitt). © Monacensia im Hildebrandhaus

Jetzt beginnen wir mit den Reisevorbereitungen. Auf die Reise nehmen wir eine Weltkarte mit, die wir selbst gestalten: Du brauchst: • blaues, etwas dickeres Papier• normales Schreibpapier• Karton, Moosgummi oder Schleifpapier• Schere• Kleber• Büroklammer oder anderes Metallstück• MagnetUnd so geht´s: • Schneide die Kontinente aus und klebe sie auf. Das geht gut auf einem blauen, etwas dickeren Papier.• Lass am besten um die Kontinente herum einen blauen Rand.• Wer möchte, kann die Kontinente beschriften.• Man kann aber auch Inseln basteln, z.B. aus Karton, aus Moosgummi, aus Schleifpapier …. Zwischen den Kontinenten und Inseln muss dabei Platz für unser Boot bleiben.• Das Boot kannst du aus kleinerem Papier falten (Faltanleitung) oder aus Zahnstochern bauen oder … Wichtig ist nur, dass unten eine Büroklammer oder ein anderes magnetisches Stückchen Metall befestigt wird. Mit Hilfe des Magneten kannst du das Boot zwischen den Kontinenten/Inseln umherfahren. Das Boot fährt auf dem Papier, wenn man den Magneten direkt unter dem Papier bewegt und so das Boot mitzieht. Die erste Station auf unserer Weltreise ist Ozeanien. Ozeanien besteht aus sehr vielen Inseln und liegt oberhalb von Australien. Ozeanien-Raumeinblick 01, Einblick in die Dauerausstellung Ozeanien. © Museum Fünf Kontinente, Foto: Nicolai Kästner Dieses echte Boot findest du im Museum in der Ozeanien-Ausstellung. In dieser Ausstellung gibt es viele verschiedene Boote zu sehen. Da die Menschen in Ozeanien auf vielen Inseln verteilt leben, sind sie oft mit dem Boot unterwegs. Früher haben die Menschen dort auch sehr viel Fisch gegessen. Um Fische zu fangen, sind sie mit den Booten aufs Meer gefahren. Unsere nächste Station ist Afrika. Recycling-Art-Maske „Dagmar Meyer“, Romouald Hazoumè, Porto Novo, Republik Benin, Afrika. © Museum Fünf Kontinente. Foto: Marianne Franke. Hier siehst du eine Maske, die der Künstler Romuald Hazoumè aus weggeworfenen Dingen gebaut hat. Kannst du erkennen, woraus? Die Nase ist ein abgebrochener Schuhlöffel und was ist der Mund einmal gewesen? Klicke auf das Bild und erfahre mehr zu dieser Maske. Jetzt sind wir in Asien angekommen! Orient-Raumeinblick 02, Einblick in die Dauerausstellung Orient. © Museum Fünf Kontinente, Foto: Nicolai Kästner Auf diesem Foto sieht man eine Vitrine aus der Orient-Ausstellung. "Orient" war früher der Name für Länder, die im Osten liegen.Hier geht es um den Islam. Der Islam ist eine weit verbreitete Religion. Das dicke Buch in der Mitte der Vitrine ist ein Koran, das heilige Buch des Islam. Im Koran sind viele wichtige Regeln und Geschichten aufgeschrieben.Um Lesen und Schreiben zu lernen, muss man viel üben. Als das Papier noch nicht erfunden war oder wenn sehr teuer war, haben die Menschen auf allen möglichen Dingen Schreiben geübt. Eine solche ungewöhnliche Übungstafel sieht man in der Vitrine ganz links. Das ist ein Knochen von einem Kamel. Dieser Knochen ist ein Schulterblatt. Wir haben auch einen solchen Knochen, aber wir können ihn nur im Spiegel erkennen, weil er hinter unserer Schulter oben im Rücken liegt. Willkommen auf dem südamerikanischen Kontinent! Der Mais kommt ursprünglich aus Südamerika und wird dort schon seit Jahrtausenden angebaut.Du hast bestimmt schon mal Mais gegessen. Magst du vielleicht Popcorn? Dann bist du hier richtig. Gefäß. © Museum Fünf Kontinente, Foto: Nicolai Kästner In dieser Pfanne haben die Menschen in Südamerika bereits vor 1000 Jahren Popcorn zubereitet.Möchtest du selbst Popcorn machen? Du brauchst: • einen Topf mit Deckel• ein bisschen Öl• getrocknete Maiskörner. Die gibt’s im Supermarkt im Regal mit den getrockneten Hülsenfrüchten und dem Reis. Und so geht’s: • Topf öffnen,• einen Esslöffel Öl hineingeben,• die Kochplatte auf mittlere Hitze schalten,• den Mais hineingeben, bis der ganze Boden mit einer Schicht davon bedeckt ist,• den Deckel schließen und abwarten, bis der Mais aufplatzt. Das kann man deutlich hören.• Wenn die Platzgeräusche weniger werden, die Platte ausschalten, den Topf öffnen und das Popcorn essen. Wer möchte, kann das Popcorn natürlich noch salzen oder zuckern oder nach Art der Ureinwohner in Kanada mit Ahornsirup mischen. Möchtest du mehr erfahren? Klicke auf das Bild mit dem Gefäß. Die letzte Station unserer Reise ist Nordamerika. Wenn man an die Ureinwohner Nordamerikas denkt, fallen einem meist ganz schnell die sogenannten Wappenpfähle ein. Diese Pfähle gibt es vor allem an der Westküste Kanadas. Die Pfähle sind meist sehr wichtig für die Familie und haben auch eine Bedeutung für größere Gruppen. Wappenpfähle im Stanley Park in Vancouver, Kanada. © Museumspädagogisches Zentrum, Foto: Susanne Bischler. Hier werden häufig Geschichten erzählt, manchmal geht es um die Entstehung der Menschen oder der Tiere. Eines ist aber jedenfalls ganz sicher: Man hat niemals Menschen an die Wappenpfähle gebunden. Das ist eine üble Geschichte, die man den Ureinwohnern angedichtet hat.Hat dir unsere kleine Weltreise Spaß gemacht? Dann schau doch mal bei uns im Museum Fünf Kontinente vorbei und nimm deine Eltern mit! Und falls du Lust hast, kannst du hier noch ein Memo-Spiel spielen: Passender Beitrag auf XponatMaske Passende MPZ-FührungenWeltreise (MS bis Jgst. 6, FöS, GS, Horte, Inklusionsklassen bis Jgst. 6)Kinder der Welt (MS bis Jgst. 6, FöS, GS, Horte, Inklusionsklassen bis Jgst. 6)Masken (GS, MS, RS, FöS, Inklusionsklassen, GYM, Horte)In 90 Minuten um die Welt (FöS, GS, Horte, Inklusionsklassen bis Jgst. 4) Informationen zum MuseumDas Museum Fünf Kontinente zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Kulturen aus Afrika, Amerika, Asien, Australien, dem Orient, der Südsee und Europa auf. HIER findest du Informationen zum Museum und seinen spannenden Ausstellungen. Abbildungsnachweis Titelbild: Kontinente. © Museumspädagogisches Zentrum, Zeichnungen: Georg Schatz

Ein ausgestopftes Krokodil hängt von der Decke; ein kostbares Kästchen, belegt mit Bernstein, eine indische Schale verziert mit Plättchen aus Perlmutt, eine Uhr in Form eines Papageis stehen in Vitrinen ... in was für einem seltsamen Museum sind wir hier gelandet? Wir befinden uns in der Kunst- und Wunderkammer auf der Burg Trausnitz in Landshut, einem Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums. Kunst- und Wunderkammern waren Vorläufer unserer heutigen Museen. Hier sammelten die Fürsten vor etwa vierhundert Jahren erlesene Kunstwerke, Kostbarkeiten aus der Natur, technische Geräte, aber auch exotische Tiere oder Materialien. Ein eifriger Sammler war Erbprinz Wilhelm von Bayern, der auf der Landshuter Burg lebte, bevor er Herzog von Bayern wurde. Erbprinz Wilhelm (V.), Christoph Schwarz?, München um 1578. ©Bayerisches Nationalmuseum München Beginnen wir mit den erlesenen, den wundersamen Kunststücken, auf lateinisch auch Artificialia genannt. Ein derart kostbares Kunstwerk ist das Kabinettkästchen mit seinen vielen Schubladen, ganz mit Bernstein verkleidet. Bernstein ist ein Naturmaterial, dem damals magische Wirkung zugesprochen wurde. Es galt als Wunder der Natur: ein „Stein“, der brennt und dabei auch noch duftet. Heute wissen wir, dass Bernstein versteinertes Harz von Bäumen und viele Millionen Jahre alt ist. Zu den Wundern der Natur, den Naturalia, gehörten Dinge, die Menschen damals als sonderbar ansahen, die sie sich noch nicht erklären konnten. Auch exotische Tiere oder seltene Mineralien, Muscheln und Schnecken zählten zu den Naturalia. Oft wurden diese Naturgegenstände zu Kunstwerken umgearbeitet oder die Künstler ließen sich dadurch zu fantasievollen Ideen anregen. Schau dir mal die kleine Öllampe an. Welche Tiere haben den Künstler wohl inspiriert? Klicke HIER oder nutze den QR-Code und gib dem Vogel einen Namen. Lade anschließend die Website neu. Du kannst auch mit deiner Handykamera diesen Code scannen! Unter den wunderbaren Dingen aus fremden Ländern, den Exotica, befand sich auch ein Material, das in Europa sehr begehrt war und aufgrund seines schimmernden Glanzes die Menschen faszinierte. Das sogenannte Perlmutt wurde aus der Innenseite von Muscheln gewonnen. Man verwendete es für Brettspiele, Tischplatten oder prächtige Schalen. Großes Perlmuttbecken, Indisch, 16. Jahrhundert. ©Bayerisches Nationalmuseum München Scientifica sind Geräte, die die Wunder ordnen. Sie dienten der wissenschaftlichen Erforschung der Welt. Hierzu gehörten beispielsweise Uhren, Geräte zur Beobachtung der Sterne und Planeten, Weltkugeln und Messgeräte. Die Uhr in Form eines Papageis war ein verrücktes mechanisches Wunderwerk. Zu jeder vollen Stunde pfiff der Papagei. Dabei bewegte er den Schnabel und die Flügel, und aus einer Klappe unter seinem Schwanz fielen Kugeln herab. Für Spaß und Überraschung war somit auch gesorgt. Möchtest du selber mit Naturmaterialien kreativ werden und ein Fantasiekunstwerk entwerfen? Unternimm dazu einen Spaziergang in den Wald, an einen Fluss oder See. Dort findest du eine Fülle an Gegenständen: Wurzeln, Zweige, Baumrinde, Steine, Federn … Gerne kannst du auch Fundstücke aus dem Urlaub, z.B. Muschelschalen, zur Ergänzung deiner Kunstwerke verwenden.Lass deiner Fantasie freien Lauf und gestalte aus den Naturmaterialien ein Kunstwerk nach deinen Vorstellungen. Gib deinem Kunstwerk abschließend einen Namen. © Museumspädagogisches Zentrum Informationen zum Museum In der Kunst- und Wunderkammer auf der Burg Trausnitz in Landshut, einem Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums, kannst du kostbare und exotische Dinge bewundern, die einst von Fürsten gesammelt wurden. Abbildungsnachweis Titelbild: Öllampe in Form eines grotesken Vogeltiers, Niederländisch Anfang 17. Jahrhundert. © Bayerisches Nationalmuseum München
Bei einer Schatzkammer denkst du bestimmt an Edelsteine, Diamanten, Gold und Silber, an kostbaren Schmuck, prächtige Schwerter oder Kronen von Königen und Königinnen – möglicherweise so bezaubernd und wunderschön wie diese Krone hier. Sie gehörte wahrscheinlich Anna von Böhmen, einer englischen Königin, die im 14. Jahrhundert gelebt hat. Die goldene Krone wurde mit Diamanten, Saphiren, Rubinen, Perlen und Smaragden prächtig verziert. Ihre Form ist einer schönen und in Königshäusern besonders beliebten Blume, einer Lilie, nachempfunden. Die Krone wurde im Mittelalter, um 1380, im westlichen Europa hergestellt und kam auf Umwegen im 15. Jahrhundert in die Münchner Residenz. Was meinst du: Gab es solch kostbare Perlen und Juwelen in Europa - oder aus welchen Ländern kamen sie? – Die Edelsteine wurden über die Seidenstraße, eine alte Handelsroute, aus dem sogenannten „Orient“ – dem heutigen China, Indien, Afghanistan und Iran – nach Konstantinopel transportiert. Diese Stadt liegt in der heutigen Türkei und heißt inzwischen Istanbul. Von dort ging die Reise dann per Schiff nach Italien, zumeist nach Venedig, und weiter in andere Städte und Länder. Die Steine legten also einen sehr langen Weg zurück, der damals viel Zeit kostete. Sie galten nicht nur als Luxusgüter, sondern man hatte auch die Vorstellung, dass ihre leuchtende Reinheit die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Außerdem sprach man ihnen Heilkräfte bei unterschiedlichen Krankheiten zu. Erkennst du die verschiedenen Edelsteine? Aus welchen Ländern kommen sie? Luxuswaren aus fernen Ländern faszinierten die Menschen. Sogenannte Naturalia, exotische Naturprodukte, waren ebenfalls heiß begehrt. Oftmals handelte es sich dabei um tierische Materialien. In der Schatzkammer der Münchner Residenz gibt es z. B. Kästchen, Truhen und Kämme aus Elfenbein sowie Gefäße aus Rhinozeroshorn, Turboschnecken oder Straußeneiern. Ein Trinkgefäß aus versteinertem Palmholz, das aussieht wie ein Schiff, gehört auch zur Sammlung der bayerischen Herrscher.Aus welchem Material wurden diese Kunstschätze geschaffen? Hör genau hin, zu jedem Objektbild gibt es ein passendes Geräusch. Die exotischen Naturalia wurden aufwändig in Gold und Silber gefasst und mit Schnitzereien oder weiteren edlen Materialien verziert. So entstanden kostbare Gefäße und Objekte für die Kunstkammern der Herrscherhäuser. Was meinst du, hatten diese Kunstwerke auch eine Funktion oder waren sie edle Kostbarkeiten für des Königs Kunstkammer? Wie es dazu kam, dass man exotische Naturalia gesammelt und ausgestellt hat, erfährst du in dem MPZ Beitrag Kostbares aus der Wunderkammer.Heutzutage gehen wir anders mit solchen „Naturalia“ aus fernen Ländern um. Der Handel mit gefährdeten Tieren oder seltenen Pflanzen ist in den meisten Ländern grundsätzlich verboten. Tiere zu töten, um zum Beispiel Elfenbein zu erbeuten, wird bestraft und von vielen Menschen abgelehnt. Dennoch sterben bis heute Tiere, weil Wilderer in Besitz ihrer Hörner oder Stoßzähne kommen, um damit Geld verdienen zu wollen.Gestaltungsidee für zu Hause: Muschelketten. Passender Beitrag auf XponatKrone Passende MPZ-FührungAuf Schatzsuche in der Residenz (Inklusionsklassen bis Jgst. 6, MS bis Jgst. 6, RS bis Jgst. 6, FöS, GS, GYM bis Jgst. 6, Horte) Informationen zum MuseumEin Besuch der Schatzkammer der Münchner Residenz ist immer ein lohnender Ausflug. Dort findest du die kostbaren Schätze der bayerischen Herrscherhäuser. Abbildungsnachweis Titelbild: Krone einer englischen Königin (sogenannte Böhmische Krone oder Pfälzische Krone; Gold, Email, Saphire, Rubine, Smaragde, Diamanten, Perlen), Westeuropa, um 1370-1380. © Bayerische Schlösserverwaltung
Warst du schon mal im tropischen Regenwald? Dort ist es heiß und die Luft ist sehr feucht. Du kommst schnell ins Schwitzen. Es rauscht und pfeift und manchmal hört man ein Zischen. Die Bäume sind so groß, dass man sogar von „Baumriesen“ spricht. Schau dir den Kapokbaum auf dem Bild an: Erkennst du den winzigen Menschen im Bild? Kapokbaum. Unsplash, Foto: Jeremy Bishop, Bearbeitung Museumspädagogisches Zentrum Ein Kapokbaum kann bis zu 75 m hoch werden und einen Stammdurchmesser von 3 m erreichen. Das bedeutet dass neun Kinder, die sich an den Händen halten, den Baum umringen könnten. Solch ein Baum ist dann etwa 500 Jahre alt. Und so sieht die Frucht des Kapokbaumes aus: Kapokfrucht und offene Kapokbaum mit Samen. © Museumspädagogisches Zentrum In jeder Frucht des Kapokbaumes sind über 100 Samen. Sie sind in der weichen Kapokfaser eingebettet. Die Samen werden über den Wind verbreitet. Außerdem bauen viele Tiere des Urwalds aus den Fasern ihre Nester und verbreiten auch so die Samen. Kapokfrüchte kann man in Tierhandlungen kaufen, für Meerschweinchen und Hamster, die ihre Nester mit der weichen Faser bauen. Außerdem werden die Fasern für Allergiker-Matratzen und für Dämmstoffe verwendet. Wenn du mehr über den Kapokbaum wissen willst, kannst du dir dazu HIER eine Geschichte anhören. Im tropischen Regenwald stehen die Baumriesen so dicht nebeneinander, dass kaum Licht auf den Boden fällt. Aber alle Pflanzen brauchen Licht, Wasser, Nährstoffe und Platz. In den tropischen Wäldern wachsen aber sehr viele Pflanzen und deshalb kann es eng werden. Was können die kleineren Pflanzen tun? Viele von ihnen keimen auf dem dunklen Boden und klettern dann an den hohen Bäumen hinauf zum Licht. Sie werden Kletterpflanzen genannt, wie zum Beispiel die Monstera, die auch Fensterblatt heißt. Monstera. © Museumspädagogisches Zentrum Die Schlitze entstehen, wenn die Blätter älter werden. Durch die Schlitze kann bei einem heftigen Tropenregen das Wasser ablaufen und sammelt sich nicht auf den Blättern. So knicken die Blattstiele unter der Last des Wassers nicht ab. Auch die Vanillepflanze klettert an hohen Bäumen hinauf, um ans Licht zu kommen. Gewürzvanille Vanilla planifolia. © Botanischer Garten München-Nymphenburg Die Vanillepflanze gehört zur Gattung der Orchideen und ist die einzige Art dieser Gattung, die wir essen. Die schwarzen Samen in der Kapselfrucht, der sogenannten Vanilleschote, werden für Süßspeisen verwendet. Wo die Vanille angebaut wird und wie schwierig die Ernte oft ist, erfährst du HIER. Vanillenschote. Pixabay Foto: gate74 Magst du Vanilleeis oder Vanillepudding? Oder hast du schon mal Vanillejoghurt selbst gemacht?Hier ist ein Rezept zum Ausprobieren:1 Vanilleschote450 g Naturjoghurt100 ml Schlagsahne200 g BeerenVanilleschote längs aufschneiden, das Mark herauskratzen und mit dem Joghurt vermischen. Sahne steif schlagen und unterheben. Die Beeren waschen und alles in schönen Gläsern anrichten.Schreibe das Rezept (oder nutze die Rezeptvorlage) in dein MPZ-Album und klebe ein Foto des Vanillejoghurts in einem schönen Glas dazu. Ananas von oben. Unsplash, Foto: Stephany Williams Und welche Möglichkeiten gibt es noch, im tropischen Regenwald ans Licht zu kommen? Es gibt Pflanzen, die auf den hohen Bäumen wachsen und keine Wurzeln im Boden haben. Sie werden Aufsitzerpflanzen oder Epiphyten genannt. Sie sitzen tatsächlich nur auf den Ästen und halten sich mit ihren Haftwurzeln fest. Sie sind keine Parasiten und ziehen weder Wasser noch Nährstoffe aus ihrem Trägerbaum. Eine dieser Aufsitzerpflanzen kennst du sicher sehr gut: die Ananas! Die Ananaspflanzen sitzen auf den hohen Ästen der Baumriesen. Und woher nehmen sie das Wasser? Schau dir das Bild an. Die Blätter sind wie ein Trichter geformt, in dem die Ananaspflanze das Regenwasser sammeln kann. Für den Handel allerdings wird die Ananas auf Feldern angepflanzt, um sie besser ernten zu können. Die Bauern, die auf den Feldern arbeiten, verdienen oft kaum so viel, dass sie und ihre Familien davon leben können. Deshalb achte auf das Zertifikat für Fairen Handel, wenn du Ananas im Supermarkt kaufst. Oder du pflanzt selbst Ananas an. Das ist gar nicht so schwierig. HIER kannst du lesen, wie es geht. Es gibt auch Orchideenarten, die sich auf die Baumriesen setzen. Orchideen halten sich mit ihren Haftwurzeln an den Ästen fest. Erkennst du die frei in der Luft hängenden Wurzeln auf dem Foto? Damit nehmen die Pflanzen das Wasser aus der feuchten tropischen Luft auf. Orchideen. © Botanischer Garten München-Nymphenburg So gibt es in den verschiedenen Schichten des tropischen Regenwalds viele Pflanzen, die auf unterschiedliche Weise an das lebensnotwendige Licht und Wasser kommen. Bei einem Besuch in den Gewächshäusern des Botanischen Gartens München-Nymphenburg kannst du solche Pflanzen anschauen. Passende MPZ-FührungenPflanzen der tropischen Regenwälder (MS, RS, BS, FöS, GS, GYM, Horte)Die Wiese – Lebensraum für Pflanzen und Tiere (MS ab Jgst. 7, RS ab Jgst. 7, GYM ab Jgst. 7, BS) Informationen zum MuseumBei einem Besuch im Botanischen Garten München-Nymphenburg kannst du viele Pflanzen mit ausgefallenen Formen und Farben entdecken.Der Botanische Garten gehört mit 21,2 Hektar Fläche und 19.600 Arten und Unterarten zu den bedeutendsten Botanischen Gärten der Welt. Du kannst dir auf der Internetseite des Botanischen Gartens anschauen, was es HIER sonst noch zu sehen gibt. Abbildungsnachweis Titelbild: Kapokbaum (Ausscnitt). Unsplash, Foto: Jeremy Bishop, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum

Stell dir vor, eine große politische Gefahr in Form einer Diktatur braut sich über deinem Land zusammen. Wie kannst du dich in dieser Situation verhalten? Mit welchen Mitteln könnten die Menschen gegen die Bedrohung ankämpfen? Vor diesen Fragen stand auch die Schauspielerin und Publizistin Erika Mann mit ihrem politischen Kabarett die „Pfeffermühle“. Post its: © Münchner Stadtbibliothek / Monacensia zur Ausstellung "Erika Mann // Kabarettistin // Kriegsreporterin // Politische Rednerin". Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum Fühlst du dich durch diese Sätze angesprochen? Welche Gedanken und Empfindungen gehen dir beim Lesen durch den Kopf? Erika Mann, 1948. Foto: Florence Homolka.Quelle: Münchner Stadtbibliothek / Monacensia Die beiden Zitate stammen aus den Liedern Prinz von Lügenland und Kälte. Erika Mann hat diese Lieder für das Bühnenprogramm der „Pfeffermühle“ geschrieben. Die „Pfeffermühle“ war das erste Kabarett, das erste politische Theater, das von einer Frau geleitet wurde. Sie war verantwortlich für die Texte, die Aufführungen und die Organisation. Erika Mann erkannte seit den frühen 1930er Jahren in den Wahlerfolgen und dem wachsenden politischen Einfluss der Nationalsozialisten eine Gefahr für Deutschland. Ursprünglich nicht sonderlich politisch interessiert, wurde sie 1932 als Schauspielerin selbst zur Zielscheibe nationalsozialistischer Angriffe. Ab diesem Zeitpunkt kämpfte Erika Mann gegen Ungerechtigkeit und Hass. Seit Januar 1933 bezog sie mit der „Pfeffermühle“ erfolgreich Position gegen die Nationalsozialisten, bis im März die NSDAP endgültig die Macht in Deutschland übernahm. Kurz darauf emigrierte Erika Mann mit dem Ensemble der „Pfeffermühle“ in die Schweiz. Von Zürich aus gab die Gruppe über tausend Gastspiele in ganz Europa. Auf Druck der Nationalsozialisten wurde das Kabarett 1937 vom Kanton Zürich verboten. Erika Mann als Pierrot in der „Pfeffermühle“, 1934. Quelle: Münchner Stadtbibliothek / Monacensia In New York versuchte Erika Mann mit der „Pfeffermühle" einen Neustart, der allerdings misslang. Dennoch blieb sie eine Frau, die sich als Kriegsreporterin in Diensten der U.S. Army und als politische Rednerin und Publizistin stets gegen Ungerechtigkeit, Hass und Krieg einsetzte. Was meinst du, haben die beiden Zitate von Erika Mann aus dem Jahr 1934 auch heute noch Gültigkeit? Übrigens: Erika Mann ist die Tochter des berühmten Schriftstellers Thomas Mann, aber als diese wollten wir sie hier ganz bewusst nicht vorstellen. Eine Kurzbiografie zu Erika Mann findest du HIER. In diesem Videoausschnitt kannst du Erika Mann erleben, wie sie über die „Pfeffermühle“ berichtet. Passende MPZ-FührungenDer "Zauberer" und seine Kinder – Leben und Werk der Familie Mann (GS Jgst. 4, MS, RS, GYM, Horte)Verboten, verbrannt, vertrieben ... Münchner Schriftsteller im Exil (GS Jgst. 4, MS, RS, GYM, Horte) Informationen zum MuseumDie Monacensia im Hildebrandhaus, Literarturarchiv und Bibliothek, ist das literarische Gedächtnis der Stadt München, und bewahrt den umfangreichen schriftlichen Nachlass von Erika Mann. Die Wanderausstellung "Erika Mann // Kabarettistin // Kriegsreporterin // Politische Rednerin" der Münchner Stadtbibliothek / Monacensia ist noch als Virtuelle Ausstellung auf dem Portal Künste im Exil der Deutschen Nationalbibliothek zu sehen. Abbildungsnachweis Titelbild: Florence Homolka, Ernest E. Gottlieb (Foto). Quelle: Münchner Stadtbibliothek / Monacensia. Collage Ingo Mesker (Ausschnitt) / Goethe-Institut Tschechien
Für viele Münchnerinnen und Münchner ist die Isar das Herz der Stadt und ein absoluter Lieblingsort. Doch die Isar und ihre grüne Umgebung sind noch so viel mehr. Ohne diesen Fluss würde es München, so wie wir es kennen, nämlich gar nicht geben! In diesem Film erfährst du, welch wichtige Bedeutung die Isar für die Stadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner hat – heute genau wie damals. Nachhaltigkeit 17ziele.de 17ziele.de Damit die Isar also ein so wunderschöner Erholungsort mitten in unserer Millionenstadt bleibt, müssen wir der Natur ihren Raum geben und sie achten. Die Vereinten Nationen haben in diesem Sinne gemeinsam 17 Ziele für eine nachhaltige Welt beschlossen, die bis zum Jahr 2030 von allen Nationen umgesetzt werden sollen. Ziel 6 besagt, dass wir uns um sauberes Wasser, auch in unseren städtischen Gewässern, bemühen müssen. Das Nachhaltigkeitsziel 14 betrifft das Leben im und unter Wasser, das geschützt werden muss. Informationen zum MuseumIn der Ausstellung „Typisch München“ im Münchner Stadtmuseum kannst du mehr über die Entstehung Münchens und die Isar erfahren. Hier findest du auch die im Film gezeigten Objekte und kannst sie dir noch genauer anschauen. Anmerkung für Lehrkräfte, Museumspädagog*innen und Vermittler*innenAnhand des Films lassen sich auch aktuelle Bezüge zu den globalen Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der Vereinten Nationen in Hinblick auf nachhaltige Städte (Ziel 11), sauberes Wasser (Ziel 6) und das Leben unter Wasser (Ziel 14) herstellen und gemeinsam mit den Schüler*innen auch Themen wie Natur- und Artenschutz besprechen. Abbildungsnachweis Titelbild: Ausschnitt aus dem Film „Alles im Fluss. München und seine Isar“. © Münchner Stadtmuseum und Museumspädagogisches Zentrum
Mache dich mit deiner selbstgemachten Blickpunkte-Karte auf eine Entdeckungstour kreuz und quer durchs Kunstareal in München. Der Blick durch ein rundes Loch macht auf so Manches aufmerksam! Lust auf eine Museumstour? Gestalte deine ganz persönliche Durchblick-Karte! Schneide dazu in einen dünnen Karton ein rundes Loch oder eine andere geometrische Form, die dir gefällt – oder verwende eine Stanze. Gestalte den Karton in deiner Lieblingsfarbe. Und los geht’s! Wo findest du Motive, Kompositionen, kleine Details oder ganze Exponate in deiner Form? Stell deine Funde in einer Fotowand zusammen. Oder fertige auf Karten gleicher Größe jeweils eine kleine Skizze an und montiere die Skizzen auf einem farbigen Blatt zusammen. Alternativ kannst du auch eine Mini-Ausstellung in einem Schuhkarton zusammenstellen. Eine Inspiration findest du HIER. Zeichne, dichte, erfinde ... Lass dich vom Blick durch das runde Loch und durch die Exponate inspirieren – zu kurzen Gedichten, zum Abzeichnen eines Ausschnittes, zum Wechseln der Perspektive, zum Nachdenken, zu eigenen Ideen. Teile deine runden Entdeckungen und deinen Blick auf die Dinge, deine Ideen, Erfindungen, Entwürfe oder Zeichnungen auf Instagram oder Facebook und nutze den Hashtag #MPZkunstareal. Tondi und andere runde Bildflächen Gibt es runde Kunst in den Museen im Kunstareal? Aber klar! Zum Beispiel eine auf Pappelholz gemalte Anbetung des Kindes aus der Renaissance, jede Menge Gefäße aus der Antike, aber auch Zeitgenössische Kunst. Fra Bartolommeo, Anbetung des Kindes, um 1495, Pappelholz, 99,1 x 98,6 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, CC BY-SA 4.0 Schale des Exekias, Ton, 540-530 v.Chr. © Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek München, Foto: Renate Kühling Auf einer runden Bildfläche – einem Tondo – eine Geschichte erzählen – das wirft die Frage auf: Wie die Figuren anordnen? Schnapp dir einen runden Bierdeckel oder zeichne einen Kreis auf ein Blatt – eine Tasse, ein Glas, eine Schüssel oder der Zirkel sind hilfreich hierbei – und probiere es aus! Lass dich inspirieren von Fra Bartolommeo. Er staffelte das Jesuskind, den kleinen Johannes den Täufer und einen Engel am rechten Bildrand entlang. Noch mehr Tondi gibt es in den Museen im Kunstareal und in deren Depots – zum Beispiel von Jan Brueghel d. Ä., Hans Holbein d. J., Karin Sander, Luca Signorelli oder Andy Warhol. Doch runde Bildflächen können zudem gekrümmt sein, wie beispielsweise bei einer Trinkschale. – Das Foto lässt uns von oben in die Trinkschale hineinblicken. Sie ist dem Gott des Weines, Dionysos, gewidmet. Mit einem Durchmesser von 30,5 cm ist sie viel größer als unsere Weingläser heute. Im Kreis herum - Perspektivenwechsel Immer im Kreis herum geht es bei Ernst Ludwig Kirchner. Nimm gedanklich verschiedene Perspektiven ein: als Betrachter*in des Gemäldes oder als Gast in der Manege. Versetze dich auch in die Rolle der Artistin! Wie nimmt sie wohl die Manege, das Publikum wahr? Ernst Ludwig Kirchner, Zirkus (Zirkusreiterin), 1913, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Sammlung Moderne Kunst in der Pinakothek der Moderne München, CC BY-SA 4.0 AxB Architecture Studio, Yin Hsi East Gate, Hsinchu City, Taiwan, 2017 – 2019. © Os Photography Studio / Rex CHU – das Modell war in der Ausstellung Taiwan Acts des Architekturmuseums der TUM zu sehen Verzerrt? Wie von einem Kreisverkehr umgeben wirkt das in den Straßenverkehr eingebettete Osttor von Hsinchu City in der nächtlichen Aufnahme. Doch die Kameraperspektive verzerrt das in Wirklichkeit langgestreckte Oval so stark, dass sich ein Kreis vermuten lässt. Nimm die Blickpunkte-Karte zur Hand und beobachte genau: Wann siehst du einen Kreis – den Rand einer Tasse zum Beispiel – als Oval, wann ein Oval als Kreis? Spiralen Nicht wirklich rund sind Spiralen. Denn die Kurve einer Spirale – auch Schneckenlinie genannt – entwickelt sich um einen Punkt herum. Ammonite haben annähernd die Form einer logarithmisch aufgebauten Spirale. Wie die Welt wohl vor 155 Millionen Jahren aussah, als dieser Lithacoceras – ein Verwandter der Tintenfische, der uns heute als Ammonit erhalten ist – lebte? In der Gestaltung vergleichbar, aber viele Millionen Jahre jünger ist das Mahnmal zur Bücherverbrennung am Münchner Königsplatz, das hier erst seit Mai 2021 zu sehen ist. Ammonit Lithacoceras (Tintenfischverwandter) aus dem Oberjura Frankens (ca. 155 Millionen Jahre), Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, Geologisches Museum Arnold Dreyblatt, The Blacklist / Die Schwarze Liste, 2021, Stahlbeton, d = 8 m, München, Königsplatz. © NS-Dokumentationszentrum München, Foto: Connolly Weber Arnold Dreyblatt verewigte in seiner Arbeit „The Blacklist / Die Schwarze Liste“ die Buchtitel von 310 Autor*innen, deren Werke 1933 verbrannt wurden. Er ordnet sie in Form einer Spirale an und bettet sie in eine kreisrunde Fläche ein. Wie lassen sich die Titel wohl am besten entziffern? In Bewegung Cy Twombly, Untitled (Roses), 4 Teile, Acryl und Kreide auf Holz, 252.5 x 742.9 cm, 2008, Museum Brandhorst. © Cy Twombly Foundation, Foto: Nicole Wilhelms, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München Wie kam die Farbe auf die Holzplatte? Um die großformatigen Rosen zu malen, montierte Cy Twombly den Pinsel an einen Stab und setzte den Körper ein. Versuche, die runden Bewegungen nachzuvollziehen, die der Künstler mit seinem Arm gemacht hat! Stell dir vor, du möchtest an eine Zimmerwand eine riesige Rose malen. Vielleicht hast du ja auch Lust, ein Rosen-Gedicht mit flüssiger Farbe auf eine große Pappe zu schreiben und die passende Blüte dazu zu gestalten? Eine große, ausholende Bewegung ist auch nötig, um einen Diskus weit zu werfen. Versuche, dich so hinzustellen wie dieser Diskuswerfer aus dem antiken Griechenland! Heute wiegt ein Diskus für Männer übrigens 2 kg und hat einen Durchmesser von 22 cm, der Diskus für Frauen ist nur halb so schwer. Rekonstruktionsversuch des Diskobol von Myron, 5. Jhdt. v. Chr., Original (Kopf und Körper) Rom, Gipsabguss. © Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke, Foto: Roy Hessing Detail des Altars des Domitius Germanicus. Hochzeit von Poseidon und Amphitrite, dargestellt im Marmorfries, Mitte 2. Jhdt. v. Chr., Marmor. © Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek München, Foto: Renate Kühling Doch Rundes lässt sich nicht nur bewegen, Rundes bewegt auch. Und so lassen sich der Meeresgott Poseidon und seine Braut Amphitrite im Hochzeitswagen fahren, begleitet von Meeresmischwesen und Schlangen. Tupfen und mehr Für die Propyläen am Königsplatz und für zahllose weitere Prachtbauten wurde er verwendet: Untersberger Marmor. Typisch sind die beige, manchmal rosa bis gelbliche Färbung und die „Tupfen“. Ein Schnitt durch den Kalkstein macht den etwa 85 Millionen Jahre alten Abtragungsschutt des aus dem Meer aufsteigenden Alpengebirges sichtbar. Die im Gestein enthaltenen rundlichen Gerölle – die Tupfen – bestehen aus noch älteren kalkigen Meeresablagerung der Trias- und Jura-Zeit. Untersberger Marmor, poliert, Platte: 2 x 1,4 m, Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, Geologisches Museum Wassily Kandinsky, Das Bunte Leben, 1907, Tempera auf Leinwand, 130 x 163 x 2,2 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Leihgabe der BayernLB, CC BY-SA 4.0 Komponiert sind die Punkte hingegen bei Kandinsky. Im Getümmel der Tupfen und Striche auf schwarzem Grund lassen sich jede Menge finden. – Zugegeben, kreisrund sind die wenigsten. Sie stehen für Köpfe, Blumen, Lichter, … Probiere es selbst einmal aus: Setze farbige Tupfen auf schwarzes Papier und gestalte damit ein buntes Bild voller Leben! Verwende dazu weiche Farbstifte, Öl- oder Wachsmalkreiden oder Farbe aus der Tube. Auch wenn es schwerfällt: Lass dabei die Umrisslinien weg und stattdessen einfach den Untergrund frei. Rund, rund, rund ... Mit dem Runden im Fokus fallen uns plötzlich überall runde Formen auf: Nahezu runde Äpfel oder Melonen in Stillleben, die drei goldenen Kugeln des Heiligen Nikolaus, Walter de Marias Large Red Sphere im Türkentor, Kompositionen, die einen runden Ausblick eröffnen wie bei Joseph Anton Koch, die Doppelsäule 23/70 von Erich Hauser, die Säulen der Tempelfronten am Königsplatz, die Rundstützen an der Südseite der Alten Pinakothek, die Rotunde in der Mitte der Pinakothek der Moderne, die runden Stelen, die dir stets Orientierung im Kunstareal geben … Paul Cézanne, Stillleben mit Kommode, um 1883/87, Öl auf Leinwand, 73,3 x 92,2 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Sammlungsbestand Neue Pinakothek – derzeit ausgestellt in der Alten Pinakothek, CC BY-SA 4.0 Kreuz und quer durchs Kunstareal 5000 Jahre Kulturgeschichte warten im Kunstareal auf dich. Antike Gefäße oder Skulpturen, Gemälde aus verschiedenen Zeiten, modernes Design und Architektur. Dazu noch Relikte aus uralten Zeiten - jahrmillionenalte Gesteine oder Fossilien zum Beispiel. Doch wo findest du was? Bringe die Dinge mit den richtigen Museen zusammen! Memospiel "Kunstareal" Welches Exponat gehört zu welchem Museum? Finde die zusammengehörigen Paare. Nachhaltigkeitsaspekte 17ziele.de Während des Kunstareal-Festes ist der Eintritt in die Museen im Kunstareal und die Teilnahme an sämtlichen Programmangeboten frei - damit allen Menschen ein Zugang zu Kunst, Kultur und Bildung ermöglicht wird. Passender Beitrag auf XponatAkrostichon Informationen zum Museum5000 Jahre Kulturgeschichte! Das Kunstareal liegt mitten in München und bildet mit Museen und Hochschulen auf einer Fläche von 500 x 500 m einen der wichtigsten Kulturstandorte Europas. Einen Faltplan zum Download gibt es hier: Faltplan Kunstareal (Deutsch) Abbildungsnachweis Titelbild: Blickpunkte - Kunstareal 2021. © Kunstareal München (Plan) und Museumspädagogisches Zentrum München
Kennst du Jupiter, Venus & Co.? Nein? Dann bist du hier genau richtig! Genauer gesagt: im RömerMuseum in Weißenburg, denn hier gibt es viele der römischen Götter zu sehen. Im gesamten Museum kannst du die verschiedenen Gottheiten entdecken, aber besonders viele kleine Götterstatuen sind im Schatzfund aus Weißenburg zu finden. Wieso hat man diese hier gefunden? Das liegt daran, dass die Region um Weißenburg, genau wie viele andere Gebiete in Deutschland, früher einmal zum Römischen Reich gehörte. Herkules – DER Superheld Eine der Figuren ist Herkules, der größte Held der Antike. Der Vater von Herkules ist Jupiter, der oberste Gott. Seine Mutter ist ein Mensch. Als Halbgott hat Herkules natürlich auch außergewöhnlich viel Kraft. Berühmt ist er vor allem durch die zwölf scheinbar unlösbaren Aufgaben geworden, die er gemeistert haben soll. Von diesen schweren Arbeiten erzählen verschiedene Sagen. Einige sind in der hier abgebildeten Statue verarbeitet. Klicke verschiedene Gegenstände an, die Herkules auf dem Bild an und bei sich trägt, und erfahre mehr über ihre Geschichte! Wie wurden sie verehrt? Die Götter konnten sehr unterschiedlich verehrt werden. Im Alltag trugen die Menschen Ringe mit Göttern oder Götternamen darauf, oder sie besaßen ein Kästchen mit einer Götterverzierung. Manche hatten auch kleine Statuen, die zu Hause im eigenen Altar, dem lararium, standen. An öffentlichen Plätzen, zum Beispiel in Thermen oder auf Märkten, gab es Weihesteine. Für eine gelungene Unternehmung oder ein fertig gebautes Gebäude wurde dem betreffenden Gott in einer Inschrift auf dem Stein gedankt. Außerdem gab es für die Götter Tempel – also eine Art Kirchen –, in denen sie angebetet wurden. Dort machten die Menschen den Göttern kleine Geschenke, wie z.B. Votivbleche. Die Götterwelt und ihre Symbole Auf Statuetten von römischen Göttinnen und Göttern sind oft keine Namen angegeben. Häufig wissen wir nur durch die Attribute, um wen es sich handeln könnte. Attribute sind Symbole, die die Figuren bei sich haben. Sie stehen entweder für bestimmte Geschichten, die die Gottheit erlebt hat, oder für gewisse Fähigkeiten, die der Gottheit zugeschrieben werden – ähnlich wie bei Herkules. Folgend findest du ein Memory-Spiel, bei dem du das richtige Attribut der Gottheit zuordnen musst! Informationen zum MuseumMehr Informationen zum RömerMuseum und was man sonst noch so Römisches in Weißenburg entdecken kann (und das ist eine Menge), findest du HIER. Abbildungsnachweis Titelbild: Statuetten. © Archäologische Staatssammlung München, Foto: M. Eberlein, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum
Der Alte Peter und die Mönche Wer waren denn die ersten Leute, die da gelebt haben, wo heute die Stadt München ist? Und wo hatten sie ihre Häuser? Wenn wir uns die älteste Kirche in der Münchner Innenstadt genauer anschauen, können wir einiges darüber herausfinden! Steig mit uns hinauf auf den „Alten Peter“, den berühmten Glockenturm der Kirche St. Peter, und wirf einen Blick auf München. Von oben kannst du Spuren des Mittelalters im heutigen Stadtbild besonders gut erkennen. Dieser Livestream ist Teil einer Aktion zum Münchner Stadtgründungsfest am 14. Juni 2021, gemeinsam durchgeführt von Ludwig & Lola Stadtführungen in München, dem Museumspädagogischen Zentrum und dem Münchner Stadtmuseum. Klick rein und heb ab! Abbildungsnachweis Titelbild: Ausschnitt aus dem Live-Mitschnitt „Der Alte Peter und die Mönche“ – Livestream vom Alten Peter zum Stadtgeburtstag am 14. Juni 2021. © Ludwig & Lola Stadtführungen in München, Museumspädagogisches Zentrum, Münchner Stadtmuseum
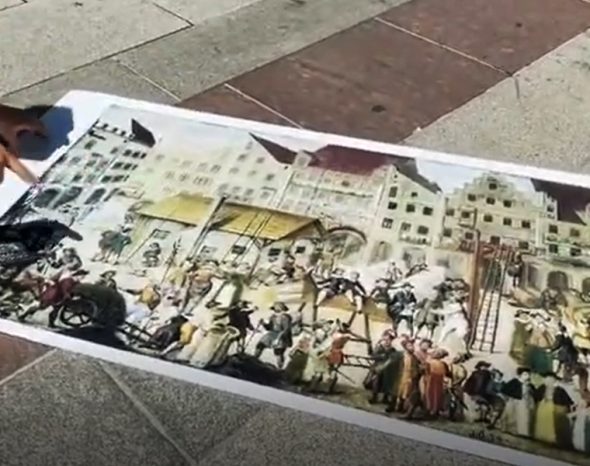
Auf dem heutigen Marienplatz herrscht oft reges Treiben: Tourist*innen, Münchner*innen, Straßenmusiker*innen, Tauben – alles durcheinander. Aber wusstet ihr, dass es hier schon seit Jahrhunderten so zugeht? Früher war der Marienplatz der Marktplatz der Stadt. Findet mit uns heraus, wie es damals hier ausgesehen hat, was die Händler so alles verkauften und wie sich der Platz in den letzten Jahrhunderten verändert hat. Dieser Livestream ist Teil einer Aktion zum Münchner Stadtgründungsfest am 14. Juni 2021, gemeinsam durchgeführt von Ludwig & Lola Stadtführungen in München, dem Museumspädagogischen Zentrum und dem Münchner Stadtmuseum. Klick rein! Abbildungsnachweis Titelbild: Ausschnitt aus dem Live-Mitschnitt „Vom Marktplatz zum Marienplatz“ - Livestream aus dem Alten Hof zum Stadtgeburtstag am 14. Juni 2021. © Ludwig & Lola Stadtführungen in München, Museumspädagogisches Zentrum, Münchner Stadtmuseum
Gemeinsam wollen wir den legendären Gründer Münchens, Heinrich den Löwen, näher kennenlernen. Was glaubst du: Wo hat ein Herrscher im Mittelalter in München gewohnt? Genau – in einer Burg! Kennst du eine Burg in München? Wir machen uns auf die Suche. Und vielleicht begegnet uns auf unserem Weg durch die Geschichte Münchens auch ein echter Ritter?! Dieser Livestream ist Teil einer Aktion zum Münchner Stadtgründungsfest am 14. Juni 2021, gemeinsam durchgeführt von Ludwig & Lola Stadtführungen in München, dem Museumspädagogischen Zentrum und dem Münchner Stadtmuseum. Klick rein! Abbildungsnachweis Titelbild: Ausschnitt aus dem Live-Mitschnitt „Heinrich der Löwe und die Ritter im Alten Hof“ - Livestream aus dem Alten Hof zum Stadtgeburtstag am 14. Juni 2021. © Ludwig & Lola Stadtführungen in München, Museumspädagogisches Zentrum, Münchner Stadtmuseum
Selbstbewusst und konzentriert zeigt sich Marianne von Werefkin (1860 – 1938). Ihr Blick besticht – mit roter Iris vor blauer Augenhaut. Die kräftigen Gelb-, Violett, Blau-, Rot- und Grüntöne im Gesicht, aber auch der kräftige Duktus lassen einen starken Charakter vermuten. Marianne von Werefkin, Selbstbildnis, um 1910, Tempera, Lackbronze auf Papier auf Karton, 51,4 x 34,2 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0 Das Brustbild zeigt die Malerin von der Seite, ihren Kopf hat sie ins Dreiviertelprofil zum Betrachter gedreht. Ein kontrollierender Blick in den Spiegel? Müssen wir uns die Staffelei, auf der das Selbstporträt entstand, rechts außerhalb des Bildes vorstellen? Zwei weitere Porträts im Lenbachhaus zeigen Marianne von Werefkin ganz anders: Gabriele Münter (1877 – 1962) zeigt ihre Bekannte freundlich lächelnd, ja fast lieblich, Erma Bossi (1882/85 – 1952) eine mondäne Dame. Alle drei Gemälde stammen etwa aus der gleichen Zeit! Vergleiche selbst und achte dabei auf Farbpalette und Pinselstrich! Künstlerin, Förderin und ihr Salon als Ort der Inspiration Marianne von Werefkins herrschaftliche Wohnung in der Giselastraße 23 in München-Schwabing war ein Ort der Inspiration und des Austausches. In ihrem „rosafarbenem Salon“ trafen sich Künstler*innen. Der Tänzer Alexander Sacharoff, Musiker, Schriftsteller, Maler*innen gingen ein und aus. Hier wurde die Neue Künstlervereinigung München N.K.V.M. gegründet. Hier lernte Franz Marc Wassily Kandinsky kennen – die beiden waren später Herausgeber und Redakteure des Almanachs Der Blaue Reiter. Hier war die Moderne zuhause.Und Marianne von Werefkin selbst? Als sie 1896 nach München kam, hatte sie sich bereits einen Namen als „Russischer Rembrandt“ gemacht. Dann verzichtete sie lange auf das Malen – ihres Lebensgefährten Alexej von Jawlensky wegen. Sie unterstützte ihn finanziell, vor allem aber auch seine künstlerische Entwicklung. Nach ihrer künstlerischen Pause entwickelte Marianne von Werefkin einen expressiven Malstil. Ihr Selbstporträt gilt als eines der ungewöhnlichsten weiblichen Selbstporträts der Kunstgeschichte. 1896. Ein Bildnis ihres Lebensgefährten aus dem Jahr, als Marianne von Werefkin nach München kam - ein fast klassisches Porträt. 1907. Nach der künstlerischen Pause. Die Einflüsse des Jugendstils sind deutlich – dazu eine spannende Farbigkeit. Um 1909. Die Farbpalette wird kräftig. 1910. Die nächtliche Straßenszene ist erst seit 2018 in der Sammlung des Lenbachhauses – und in der Ausstellung „Gruppendynamik“ zu sehen. 1917/1918. Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin als Rückenfiguren im Bild. Mehr dazu HIER. Marianne von Werefkin, Bildnis Alexej von Jawlensky, 1896, Öl auf Leinwand, 42,8 x 24,7 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München – nicht ausgestellt, CC BY-SA 4.0, Marianne von Werefkin, Wasserburg, 1907, Aquarell, Kreide auf Pappe, 50,5 x 37,5 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München – nicht ausgestellt, CC BY-SA 4.0, Marianne von Werefkin, Wäscherinnen, um 1909, Tempera auf Papier auf Pappe, 50,5 x 64,6 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Gabriele Münter Stiftung 1957, CC BY-SA 4.0, Marianne von Werefkin, In die Nacht hinein, 1910, Tempera auf Papier auf Pappe, 75,3 x 102,3 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Ankauf des Förderverein Lenbachhaus e.V. 2018, CC BY-SA 4.0 / Marianne von Werefkin, Marionettentheater – im Vordergrund Jawlensky und Marianne von Werefkin, 1917/18, Gouache, Tempera auf Papier, 24 cm x 32,2 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München – nicht ausgestellt, CC BY-SA 4.0 Künstlerinnen-Selbstporträts Noch mehr Selbstporträts von Künstlerinnen aus dem Sammlungsbestand des Lenbachhauses findest du in der Online-Sammlung: Emilie von Hallavanya (1874 – 1960), Gabriele Münter (1877 – 1962), Elisabeth Iwanowna Epstein (1879 – 1956), Anna Hillermann (1880 – ?) oder Maria Lassnig (1919 – 2014). Greife zu Pinsel und Farben! © Museumspädagogisches Zentrum Sieh dich selbst und lass dich sehen! Wie würde dein Selbstporträt aussehen? Und wie sehen dich deine Freundinnen?Fertige ein Selfie an. Oder noch besser: Greife zu Pinsel und Farbe oder zu farbigen Kreiden und schau in den Spiegel. Wähle Farben, die zu dir und deinem Charakter passen. Von welcher Seite zeigst du dich? Wähle deine Kleidung bewusst und suche nach einem passenden Hintergrund. Lege den Ausschnitt fest.Bitte zwei Freundinnen, je ein Porträt von dir zu machen – mit der Kamera oder ebenfalls mit Pinsel und Farbe, farbigen Stiften oder Kreiden.Zum Schluss vergleicht ihr eure Porträts. Wie unterscheiden sie sich? Was verraten die drei Porträts über dich?Vielleicht habt ihr ja auch Lust, euch gegenseitig zu malen oder zu fotografieren? Ihr werdet dabei eine Menge über euch erfahren.Noch mehr Anregungen zum Thema Porträt findest du hier: Upcycling! Alte Meister >< Moderne. Passende MPZ-FührungFrauenpower (MS, RS, GYM, BS, Jgst. 7 – 13)Künstlerinnen (für Lehrkräfte an RS und GYM) Passender Beitrag auf Xponat Porträt Informationen zum MuseumEinige Werke von Marianne von Werefkin findest du in der Online-Sammlung des Lenbachhauses und in der Ausstellung „Gruppendynamik“ im Lenbachhaus. Abbildungsnachweis Titelbild: Marianne von Werefkin, Selbstbildnis (Ausschnitt), um 1910, Tempera, Lackbronze auf Papier auf Karton, 51,4 x 34,2 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München (nicht ausgestellt), CC BY-SA 4.0
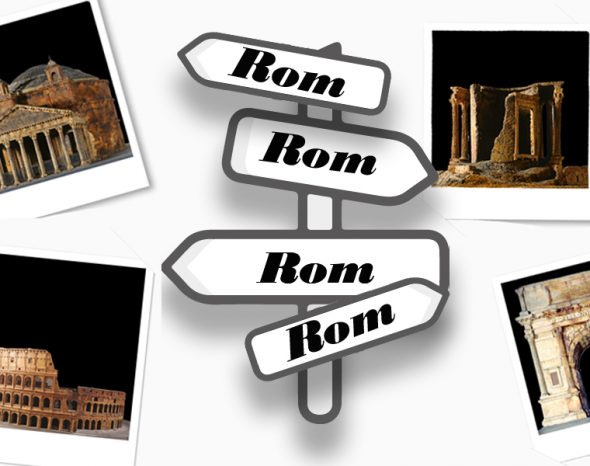
Alle Wege führen nach Rom, so heißt es. Wenn du daran nicht so recht glauben magst, dann probier´s aus und mach dich mit uns auf die Reise. – NICHT nach Süden, NICHT nach Italien und NICHT Richtung Mittelmeer, sondern in den Norden von Bayern, an den Untermain, nach Aschaffenburg. Dort besuchen wir das Schloss Johannisburg … – und landen mitten im alten Rom! Wie das sein kann? – Ganz einfach: Im Schlossmuseum gibt es Bauwerke zu sehen, die vor rund 2000 Jahren in und um Rom entstanden sind: das Kolosseum und das Pantheon, Triumphbögen, Tore, Brücken, Grabmäler, … - Und zwar nicht als Computeranimationen, sondern quasi „zum Anfassen“, als 3-D-Modelle.Lust auf eine kleine Zeitreise in die römische Antike? Dann klicke auf die Bilder und erfahre mehr über die einzelnen Bauwerke. Findest du nicht auch, dass die Modelle täuschend echt aussehen? – Richtig alt und verwittert! Wie kommt das wohl? Aus welchem Material sind sie gemacht? Wir kennen dieses Material z. B. als Verschluss von Sekt- und Weinflaschen, auch Fußböden und Wände, vor allem Pinnwände, werden daraus hergestellt … – Aber warum baut jemand daraus Modelle?Kork ist weich und biegsam und lässt sich dadurch leicht bearbeiten. Seine Farbe und die von Furchen und Rissen durchzogene Oberfläche erinnern bereits an verwitterte antike Steinfassaden. Kork ist außerdem erstaunlich lange haltbar und ein besonders nachhaltiger Rohstoff. Er wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen, die immer wieder nachwächst und besonders viel klimaschädliches CO² bindet. Apropos kurze Wege: Rom liegt nur ein paar Gehminuten von Pompeji entfernt! Zumindest in Aschaffenburg. Denn dort steht ganz in der Nähe des Schlosses, hoch über dem Main und inmitten von Weinbergen, eine gelb-weiße Villa, die sehr „italienisch“ aussieht: das sogenannte „Pompejanum“. König Ludwig I., der ein großer Fan der griechisch-römischen Antike war, hat dieses Gebäude Mitte des 19. Jahrhunderts errichten lassen. Als Vorbild diente ihm ein Haus in Pompeji. Das ist eine Stadt in der Nähe von Rom, die 79 n. Chr. durch einen Ausbruch des Vulkans Vesuv verschüttet wurde. Erst vor etwa 200 Jahren hat man angefangen, sie mit archäologischen Ausgrabungen wieder freizulegen. Und die Archäologen graben bis heute und finden immer wieder Neues! © Bayerische Schlösserverwaltung, Foto: Michael Alfen, Aschaffenburg Im Erdgeschoss des Aschaffenburger Pompejanums bekommst du einen Eindruck davon, wie die alten Römer gewohnt und gelebt haben. Alle Räume gruppieren sich um zwei von Säulen umrahmte Innenhöfe: Im vorderen Bereich befindet sich das atrium, das Herzstück des Hauses. Hier spielte sich ein Großteil des Familienlebens ab. Danach folgt das Empfangs- und Arbeitszimmer des Hausherrn, das tablinum. Es ist mit besonders prächtigen Wandmalereien und Fußbodenmosaiken ausgestattet. Daran schließt sich der zweite Innenhof an: das viridarium, ein kleiner Gartenhof. Außerdem sind im Erdgeschoss die Küche (culina), das mit Liegesofas ausgestattete Speisezimmer (triclinium) und die Schlafräume für Gäste und Bedienstete (cubicula) zu finden.Und nun bist du dran: Was ist hier wohl zu sehen? Ordne den abgebildeten Räumen des Pompejanums jeweils den passenden lateinischen Namen zu. Eine detailgetreue Kopie des Originals ist das Pompejanum allerdings nicht. Vielmehr eine ungefähre Nachbildung, da das Gebäude in Pompeji natürlich nicht ganz vollständig erhalten ist.König Ludwig I. hat ins Pompejanum auch seine eigenen Vorstellungen von römisch-pompejanischer Wohnkultur einfließen lassen. Dabei sollte der Nachbau nie als Wohnhaus dienen, sondern von Anfang an als Museum. Ludwig I. war es nämlich sehr wichtig, dass seine Untertanen sich bildeten und die römische Antike auch in Deutschland „hautnah erleben“ konnten.Auch du würdest dir gerne einmal aus der Nähe ansehen, wie die alten Römer gelebt haben, kannst aber gerade nicht nach Rom, Pompeji oder Aschaffenburg reisen? Dann bau dir doch einfach eine römische Villa aus Karton, „zum Anfassen“! Den Bausatz dazu kannst für 6,00 EUR plus Versandkosten beim Museumspädagogischen Zentrum bestellen - Klicke dazu einfach auf das Bild. Bausatz einer römischen Stadtvilla. © Museumspädagogisches Zentrum Du siehst: Auch wenn vielleicht nicht alle Wege nach Rom führen, gibt es doch viele Wege, um den alten Römern auf die Spur zu kommen! Passender Beitrag auf XponatStadtmodell Informationen zum MuseumIm Schlossmuseum Aschaffenburg und im Pompejanum erfährst du viel über antike römische Architektur und Wohnkultur. Im Pompejanum findest du auch viele Alltagsgegenstände aus dem alten Rom. Sie stammen größtenteils aus den Staatlichen Antikensammlungen und der Glyptothek in München. Abbildungsnachweis Titelbild: Objektfotografien. © Bayerische Schlösserverwaltung, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum

Wenn du einen Film machen möchtest, hast du jede Menge Möglichkeiten: Du kannst mit einem Handy, Tablet oder Laptop filmen, mit einer Videokamera oder einer normalen Digitalkamera, die eine Filmfunktion hat …Vor ungefähr 100 Jahren, als Karl Valentin seine Filme – damals noch ohne Ton – aufnahm, gab es noch nicht so viele Möglichkeiten. Doch die Grundbedingungen waren dieselben: Wer einen Film drehen will, braucht eine Story, eine Kulisse und mindestens eine*n Darsteller*in – eine*n Schauspieler*in, eine Puppe oder eine beliebige andere Figur.Am Beispiel von Karl Valentin wollen wir uns einmal ansehen, wie aus diesen Elementen ein Film entstehen kann. Alles aus einer Perspektive: Karl Valentin im Homeoffice Momentan sind viele von uns im Homeschooling oder im Homeoffice. Einer, der mit Sicherheit die alltäglichen Probleme und Ärgernisse beim Lernen oder Arbeiten von zu Hause aus mit wenig Mitteln und doch sehr eindrucksvoll hätte darstellen können, ist Karl Valentin. Der Münchner Humorist, Komiker und Stückeschreiber war unter anderem ein Pionier der Filmkunst. Seine ersten Filme entstanden in der Zeit des Stummfilms. Darin gelingt es ihm, durch seine schlaksige Figur wie eine lebendige Karikatur aufzutreten und im Stil des Slapsticks komische Situationen zu schaffen. Oft zeigen seine Filme die Tücken des Alltags oder drehen sich um ganz gewöhnliche Gegenstände. Seine Figuren schrammen auf fast schon tragische Weise meist nur knapp an großen Katastrophen vorbei.Ein Beispiel für einen frühen Film Karl Valentins ist der Einakter „Der neue Schreibtisch“. Dieser ca. 1913 entstandene Film ist Valentins erste Atelierproduktion. Eingerahmt von zwei Straßenszenen spielt die Haupthandlung an nur einem Schauplatz: in einer Schreibstube. Hier tritt Karl Valentin als eine Art Sekretär oder Schreiber mit Federkiel hinter dem Ohr auf.Doch um wirklich mit der Schreibarbeit anfangen zu können - um quasi im Homeoffice durchzustarten -, fehlen Karl Valentin noch der richtige Schreibtisch und ein passender Stuhl, die aber gerade geliefert werden.Ob Karl Valentin im Homeoffice glücklich wird, und ob du seine Gefühle und Gedanken auch ohne Ton verstehst, kannst du hier selbst testen: Du siehst: Die komplette Szene ist mit einer fest montierten Kamera aus nur einer Perspektive aufgenommen. So kannst du auch filmen: Du musst nur deine Kamera in einer festen Position halten, z.B. mithilfe eines Stativs. Oder du klebst dein Handy mit einem Klebestreifen auf einem nicht beweglichen Untergrund waagrecht oder senkrecht fest. Kein Ton – und trotzdem deutlich! Ist es nicht toll, wie es Karl Valentin schafft, mit ganz wenigen Requisiten so viele komische Effekte zu erzielen - durch seine Bewegungen, seine Gestik und Mimik? Dieser Kampf des Menschen mit den alltäglichen Problemen – hier zwischen Mann und Möbel – ist etwas, das Karl Valentin besonders überzeugend darstellt.Sieh dir einmal dieses Bild an: Ratschkathl. © Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität zu Köln. Nachlass Karl Valentin Überlege: Was drückt Valentin hier aus? Und wie macht er das?Bevor du selbst mit dem Filmen beginnst, mach noch ein paar Vorübungen:Schneide Grimassen, um ein bestimmtes Gefühl auszudrücken oder eine Reaktion bzw. Haltung darzustellen. Mach davon ein Selfie und schicke es an einen Freund oder eine Freundin. Kommt er/sie dahinter, was du mitteilen wolltest? Natürlich kann dein Freund/deine Freundin dasselbe ausprobieren und auch dir Selfies zuschicken. Außerdem kannst du HIER sehen und ausprobieren, wie sich Stimmungen in Gesichtern durch die unterschiedliche Gestaltung von Mund, Nase oder Augen zeichnerisch ausdrücken lassen. Schwerathlet. © Valentin-Karlstadt-Musäum Versuche nun, mit deinem Körper eine bestimmte Stimmung, Haltung oder Reaktion auszudrücken. Auch hier kannst du wieder Selfies machen und an jemanden schicken. Wenn du nicht selbst als Hauptdarsteller*in auftreten möchtest, kannst du auch Zeichnungen oder bewegliche Figuren anfertigen und mit wenigen Strichen bzw. Handgriffen Gefühle oder Gesten darstellen. Und nun zu deinem Film: Wie du eine Kulisse für deinen Film bauen kannst, weißt du bereits.Installiere nun dein Handy, dein Tablet oder eine andere Kamera so, dass du diesen Ort aus einer geeigneten Perspektive filmen kannst.Wenn du für den Film eine Figur benutzt, gib ihr einen Gesichtsausdruck, der die Stimmung, die du darstellen möchtest, zeigt. Einer beweglichen Figur (z.B. Playmobil oder Lego) kannst du auch eine bestimmte Körperhaltung geben. Ebenso kannst du eine Figur mit einem sprechenden Gesichtsausdruck und einer bestimmten Körperhaltung zeichnen.Mit diesen Figuren oder Zeichnungen kannst du nun einen Stop-Motion-Film drehen. Das funktioniert ganz ähnlich wie beim Daumenkino, nur digital. Du brauchst dafür eine Spezial-Software, die du dir aus dem Internet herunterladen kannst. Oft gibt es kostenlose Einsteigerpakete, auch fürs Handy.Für Stop-Motion-Filme platzierst du deine Figur/Zeichnung in der Kulisse und machst ein Foto. Dann veränderst du die Figur/Zeichnung minimal und machst das nächste Foto, veränderst sie wieder, machst erneut ein Foto und so weiter, bis du die Story fertig erzählt hast. Mit der Software baust du die Einzelbilder zu einem Film zusammen. So entsteht aus vielen winzigen Veränderungen an einem Bild oder in einer Szene ein ganzer Film. Nun brauchst du nur noch eine Story für deinen Film. Wie du die entwerfen kannst, erfährst du HIER. Übrigens: Neben seinen Filmen hat Karl Valentin sehr viele lustige Texte geschrieben. Zum Abschluss kannst du dir anhören, wie er als Sprachakrobat tätig ist. – Klicke dafür auf das Bild: © Valentin-Karlstadt-Musäum Informationen zum MuseumWenn du mehr über Karl Valentin erfahren willst, dann besuche doch einfach mal das Valentin-Karlstadt-Musäum. Abbildungsnachweis Titelbild: Barfußtänzerin bei Karl Valentin (bearbeitet). © Valentin-Karlstadt-Musäum. Nachlass Karl Valentin, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum
Wer einen Film drehen will – sei er auch noch so kurz – braucht eine Story. Und ein Drehbuch. Die Museen bieten mit ihren Schätzen dazu wunderbare Anregungen! Wie du im Museum Storys und Anregungen für dein Drehbuch findest? - Ein paar Exponate aus dem Lenbachhaus liefern dir wertvolle Tipps. Lustig, fröhlich, traurig, ernst … Eine Figur hat viele Gesichter. Je nach Gesichtsausdruck und Körperhaltung kann sie ganz unterschiedlich wirken. Mit einer Wortwolke wollen wir sehen, ob alle gleicher Meinung sind. Klicke HIER und gib mindestens drei Adjektive ein, die zum Wesen dieser Figur passen. Lade anschließend die Website neu. Du kannst auch mit deiner Handykamera diesen Code scannen! Thomas Theodor Heine, Teufel, vor 1904, Bronze, 40 x 23 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Foto: Lenbachhaus, Simone Gänsheimer, CC BY-SA 4.0 Nimm nun die Adjektive als Start für eine Geschichte! Nutze sie, um den Charakter der Figur zu beschreiben. Auch wenn die Figur in Bronze gegossen und damit unbeweglich ist, erweckt sie den Eindruck, irgendwohin zu gehen. Woher kommt sie? Wohin will sie? Gibt es ein Gegenüber?Wenn du bereits eine eigene Figur angefertigt hast, dann erfinde nun eine Geschichte, die zu dieser Figur und ihrem Charakter passt. Schau dir dazu deine Figur noch einmal ganz genau an! Auf der Bühne inszeniert Die Zuschauer im Vordergrund – als Rückenfiguren von hinten gezeigt – nehmen uns mit in den Theatersaal. Doch die Hauptrolle spielen die Figuren auf der Bühne. In grünen Gewändern vor roter Kulisse – kräftiger könnte der Kontrast nicht sein. Mit diesem Komplementärkontrast brachte die Künstlerin das Bild zum Leuchten.Doch was wird gespielt? Was erzählen uns die Kostüme? Was die Gesten? Erdenke dir eine Handlung, die genau zu dieser Szene führen könnte! Marianne von Werefkin, Marionettentheater – im Vordergrund Jawlensky und Marianne von Werefkin, 1917/18, Gouache, Tempera auf Papier, 24 x 32,2 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, CC BY-SA 4.0 Rein und raus … Als Wassily Kandinsky sein Esszimmer malte, dachte er bestimmt nicht daran, dass es uns einmal Ideen für einen Film liefern könnte. Doch der menschenleere Raum wirft Fragen auf, die uns dazu anregen können, eine Geschichte zu erfinden:Zwei Türen stehen offen, der Stuhl ist leer. Wer könnte durch welche Tür kommen, wohin sich bewegen, was ansehen oder in die Hand nehmen, wen treffen, was erzählen? Schau dir die Details genau an und denk dir etwas aus! Wassily Kandinsky, Interieur (Mein Esszimmer), 1909, Öl auf Pappe, 50 x 65 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Gabriele Münter Stiftung 1957, CC BY-SA 4.0 Gestalte selbst einen Bühnenraum – Tipps dazu gibt es HIER – und gehe ähnlich vor: Woher und wohin können deine Figuren gehen? Bringen sie etwas mit? Stell gegebenenfalls noch Ausstattungsstücke her, die für deine Story wichtig sind! … und neu gemixt Wie schnell sich eine Geschichte verändern kann, zeigt dieses Experiment: Ordne die Bestandteile eines Gemäldes von Paul Klee zu einem Bild. Verschiebe sie und probiere verschiedene Varianten aus! Wenn du fertig bist, mach einen Screenshot und speichere ihn ab. Vergleiche nun dein Werk mit „Rausch“ von Paul Klee. Wie unterscheiden sich die beiden erzählten Geschichten? Paul Klee, Rausch, 1939, 341 (Y 1), Wasserfarbe, Öl auf Jute, 65 x 80 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Dauerleihgabe der Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München, CC BY-NC-SA 4.0 In der Kürze liegt die Würze Manche Filme eignen sich auch dazu, als Dauerschleife – also in einem Loop – gezeigt zu werden. Ein Still aus Ceal Floyers Video „Unfinished“ von 1995 lässt schon erahnen, wie der Film weitergeht … – und warum er sich so gut eignet, als Loop gezeigt zu werden. Wer den Film sieht, wird sich vielleicht an eine Situation erinnern, in der sie oder er selbst die Daumen gedreht hat, oder an einen Menschen, der das immer mal wieder macht. Und schon geht der Film im Kopf weiter! Nun ist dein Film dran! Wie du beim Erfinden deiner Story vorgehst, bleibt dir überlassen. Du hast verschiedene Möglichkeiten:• Du hast bereits eine Figur, erfindest dazu eine Geschichte und baust die passende Kulisse dazu. Oder:• Du hast eine Geschichte im Kopf, stellst die entsprechende(n) Figur(en) her und baust die Kulisse. Oder:• Du lässt dich von deiner Kulisse anregen zu einer Geschichte und schaffst dazu die passende(n) Figur(en).• Wenn du noch eine zündende Idee brauchst, dann lass den Zufall mitspielen. Schreibe dazu auf ein paar Zettel Adjektive, die die Art deines Filmes beschreiben: lustig, kurios, traurig, komisch, … Steck die Zettel in einen Beutel und ziehe blind.TIPP: Noch mehr Ideen für eine Geschichte gibt es HIER. Nun geht es an die Detailplanung:• Falls du keinen Stummfilm drehten möchtest: Steht der Text?• In welche Richtung bewegt sich welche Figur vor deiner Kulisse?• Welche Farben soll der Film haben?• Sind noch Requisiten notwendig?• Mach dir auch mal eine Zeichnung von einer geplanten Szene! Sobald alle Vorbereitungen fertig sind, geht es los. Film ab! Passende MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Tanzende Formen, fantastische Träume und farbige Klänge. Künstler*innen um den Blauen Reiter (GS ab Jgst. 2, MS bis Jgst. 8, RS bis Jgst. 8, GYM bis Jgst. 8) Passende MPZ-FührungGrüne Nasen, gelbe Kühe und der Blaue Reiter (MS, RS, FöS, GS, GYM, Horte, Inklusionsklassen, BS)Wassily Kandinsky – auf dem Weg der Abstraktion (MS, RS, GS, GYM, Horte, BS)Erzählen, schreiben, dichten ... (GS ab Jgst. 3, MS bis Jgst. 7) Passender Beitrag auf XponatExpertentipp Informationen zum MuseumDie Sammlung der Städtischen Galerie im Lenbachhaus gliedert sich in drei Sammlungsbereiche: 19. Jahrhundert, Der Blaue Reiter sowie Kunst nach 1945. Entdecke die Werke dieser Städtischen Sammlung online! Abbildungsnachweis Titelbild: Marianne von Werefkin, Marionettentheater – im Vordergrund Jawlensky und Marianne von Werefkin (Ausschnitt), 1917/18, Gouache, Tempera auf Papier, 24 x 32,2 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, CC BY-SA 4.0
Ein Film kann überall gedreht werden: auf der Straße, im Park, in einem Museum oder in einem einzigen Zimmer. Den Möglichkeiten für ein entsprechendes Setting sind keine Grenzen gesetzt. Ähnlich wie in den großen Filmstudios kann man natürlich auch eine Filmkulisse bauen. Der folgende Ausflug in eine prächtige Künstlervilla kann dir als Anregung dienen, eine Fantasie-Filmkulisse zu entwerfen.Lass uns eine kleine Reise in die Zeit um 1900 unternehmen. München war damals eine boomende Kunststadt. Viele bekannte Künstler versuchten ihren Ruhm in prächtigen und palastähnlichen Villen zum Ausdruck zu bringen. Zu ihnen gehörte der Maler und Bildhauer Franz von Stuck, der sich 1897/98 in der Prinzregentenstraße eine große, extravagante Villa mit einzigartiger Innenausstattung errichten ließ. Die Innenräume dienten Franz von Stuck als Ort der Inszenierung, wenn er Besuch empfing.Werfen wir einen Blick in den Musiksalon im Hause Stuck: Alle Wandflächen und die Decke sind bemalt und größtenteils auch künstlerisch ausgestaltet. In den verschiedenfarbigen Wandfeldern finden sich Gemälde, Reliefs oder rankende Fantasiepflanzen. Zum Thema des Musiksalons passt besonders gut die Geschichte des antiken Sängers Orpheus, der mit seinem zauberhaften Gesang selbst die wildesten Tiere zähmen konnte. Die kostbaren Möbel sind eigens für den Raum geschaffen und scheinen optisch mit den Wänden zu verschmelzen. Musiksalon mit Orpheus-Wand. © Museum Villa Stuck, Foto: Wolfgang Pulfer Raffiniert gestaltet Franz von Stuck auch den Übergang von der Wand zur Decke. Die flächige Wandgestaltung wird hier plötzlich dreidimensional. Aber Vorsicht: Es handelt sich nur um eine optische Täuschung! Im oberen Drittel der Wand „erheben“ sich plötzlich dreidimensionale Pfeiler, auf denen eine Pergola, ein sogenanntes Schattendach, aufliegt. Solche Dächer werden seit der Antike für die Gestaltung schattiger Terrassen oder Gänge in herrschaftlichen Gartenanlagen verwendet. Durch die Balken der Pergola kann man im Musiksalon den Sternenhimmel erkennen. Letztendlich weiß der Betrachter nicht mehr genau, wo die Grenze zwischen Decke und Wand verläuft. Befinden wir uns noch in einem Innenraum oder bereits in einem Garten? Derartige malerische Spielereien, die die Andeutung von Dreidimensionalität erzeugen, nennt man auch Scheinarchitektur. Musiksalon mit Pan-Wand. © Museum Villa Stuck, Foto: Wolfgang Pulfer Der Musiksalon ist eine prächtige Kulisse für Konzerte und ein Raum für die Selbstdarstellung des Hausherrn - oder auch der Hausherrin. Man stelle sich vor, wie Mary von Stuck hier mit Klavierbegleitung vor Publikum gesungen hat!Lass dich nun vom Musiksalon der Villa Stuck inspirieren und baue deine eigene kleine Filmkulisse! Mit Pappe, bunten Papieren, Abbildungen aus Zeitschriften, Klebstoff und Schere kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Inspiration für Kulissen. © Museumspädagogisches Zentrum, Fotos: Judith Schenk Vielleicht schaffst du es sogar, ein paar Tricks oder optische Täuschungen einzubauen, damit deine Bühne besonders prächtig, faszinierend oder einfach „realistisch“ wirkt? Zum Beispiel solltest du im Hinblick auf das anschließende Filmen darauf achten, dass die Größenverhältnisse zwischen dem Raum und den Figuren, die du darin bewegen möchtest, in etwa stimmen. Zudem solltest du deine Kamera – sei es das Smartphone, ein Tablet oder ein Notebook – so aufstellen, dass sie mit dem oberen Rand der Raumkulisse abschließt. Passende FührungenWohnen, arbeiten und feiern: Ein Künstler und sein Haus (MS bis Jgst. 7, RS bis Jgst. 7, GS, GYM bis Jgst. 7, Horte)Programm für Deutschklassen: Ein Haus voller Fantasie (Deutschklasse GS, Deutschklasse MS Jgst. 5-6) Informationen zum MuseumDie historischen Räume der Villa Stuck gewähren einzigartige Einblicke in eine Künstlervilla um 1900. Darüber hinaus werden Wechselausstellungen zur Kunst des 19. bis zum 21. Jahrhundert präsentiert. Abbildungsnachweis Titelbild: Decke im Musiksalon (Ausschnitt). © Museum Villa Stuck, Foto: Jens Weber
Um eine Geschichte zu erzählen, brauchen wir Protagonist*innen - also Personen, die sozusagen die Handlung „zum Leben erwecken“. In Film und Theater übernehmen Schauspieler*innen diese Rolle(n). Wahrscheinlich fallen dir dazu auf Anhieb die Hauptdarsteller*innen deiner Lieblingsfilme ein. Nun, Geschichten können auf unterschiedliche Art und Weise erzählt werden – nicht nur in Film und Theater, mit „lebendigen“ Darsteller*innen. Auch sogenannte Spielfiguren – also Marionetten, Handpuppen, Stab- und Schattenspielfiguren - verkörpern unterschiedlichste Charaktere in Theaterstücken. Eine der bekanntesten Figuren in Deutschland ist sicher der Kasperl, der in vielen Ländern die Rolle des Spaßmachers übernimmt, aber natürlich überall einen anderen Namen hat. Von links nach rechts: Franz von Pocci, Marionette "Professor Fleischmann", Münchner Marionettentheater, 1861. © Münchner Stadtmuseum, Sammlung Puppentheater / Schaustellerei, Foto: Ernst Jank; Emil Preetorius, Schattenspielfigur „Riese“, Schwabinger Schattenspiel, 1908. © Münchner Stadtmuseum, Sammlung Puppentheater / Schaustellerei; Till de Kock, Handpuppe "Kasperl", Puppenbühne der Verkehrspolizeiinspektion München, um 1965. © Münchner Stadtmuseum, Sammlung Puppentheater / Schaustellerei Figurentheater – kein „Kinderkram“! Falls du glaubst, das alles wäre nur „Kinderkram“, dann hast du dich getäuscht: Die ersten Kasperlstücke waren derbe Unterhaltung für Erwachsene, gespielt als Straßentheater auf Volksfesten und Märkten. Schattenspielfiguren, die Erwachsene und Kinder unterhalten, haben sich ausgehend von Asien über die ganze Welt verbreitet. Bis heute gibt es Figurentheater für Erwachsene, bei dem Spielfiguren und Schauspieler*innen zum Teil gemeinsam auf der Bühne auftreten. Fingerspielfigur Collage. © Museumspädagogisches Zentrum Auf der Bühne agieren - genau das wollen wir hier auch. Und zwar nicht mit Schauspieler*innen, sondern mit einer einfach herzustellenden Papierfigur, die wir als Collage aus alten Illustrierten, Postkarten oder Flyern anfertigen. Die Inspiration Marionetten aus den 1970er und 80er Jahren, die damals in einem Theater für Erwachsene aufgetreten sind, dienen dir als Inspirationsquelle. Die Spielfiguren sind vielleicht auf den ersten Blick ungewöhnlich, da sie sich von denjenigen des traditionellen Marionettentheaters unterscheiden. Der Künstler Ben Vornholt hat sich für seine Marionetten von der Kunst der 1920er Jahre inspirieren lassen. Marionette „Drahtkorb-Kopf“, Ben Vornholt, „Die Klappe. Das Kabarett an Fäden“, 1973. © Münchner Stadtmuseum, Sammlung Puppentheater / Schaustellerei, Foto: Ernst Jank Also, ich darf vorstellen: Unsere Figur heißt „Drahtkorbkopf“-Marionette. Der übergroße Drahtkorbkopf mit den intensiv blickenden, kugelrunden Augen lenkt sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Körper, Arme und Beine wirken dagegen fast verschwindend klein und zart. Die Proportionen der Marionette sind, wie oft auch in der modernen Kunst, bewusst nicht naturgetreu. Wie wirkt sie dadurch auf dich? Ist der Blick frech und vorwitzig oder eher besserwisserisch? Die Augen scheinen zu sprechen. Spricht auch der Mund, der nur ein kleiner roter Strich ist? Typen, Rollen und Charaktere gesucht! Wenn du der Figur deine Stimme leihst, was würde diese Marionette wohl sagen? Was für eine Rolle könnte sie spielen? Ist sie lustig und frech, nett und freundlich oder …? Notiere dir deine Ideen auf einem Ideenzettel.Vergleiche nun diese Figur mit einer anderen Drahtkorbkopf-Marionette. Zunächst scheinen sich die beiden sehr ähnlich zu sehen. Doch der Ausdruck beider Figuren ist unterschiedlich. Wodurch entsteht dieser Ausdruck? Und wie verhalten sich Kopf, Kinn, Hals und Körper in ihrer Gestaltung zueinander? Die Drahtkorbkopf-Marionetten traten einst in dem Göttinger Theater „Die Klappe. Kabarett an Fäden“ auf, einem Theater für Erwachsene. Gespielt wurden oftmals nur kurze, kleine Szenen und keine abendfüllenden Stücke. Sie waren pantomimisch. Lediglich Klanggeräusche und Musik begleiteten die Aufführungen. Die beiden szenischen Stücke unserer Marionetten hießen „Typen“ bzw. „Konversation“. Welche „Typen“ haben die beiden Drahtkorbkopf-Marionetten wohl verkörpert und welche Konversation, welche Unterhaltung, haben sie miteinander geführt?Ganz zum Schluss lassen wir noch eine weitere Marionette auf der Bühne auftreten. Es ist das „Gelbe Wesen“. Wie gefällt es dir? Marionette „gelbes Wesen“, Ben Vornholt „Die Klappe. Das Kabarett an Fäden“, 1985. © Münchner Stadtmuseum, Sammlung Puppentheater / Schaustellerei, Foto: Ernst Jank Welche Geschichte oder welches Gespräch wird sich nun unter den drei Marionetten entwickeln? Notiere deine Ideen. Deine Papierfigur Und nun zu deiner Figur. Wie soll sie aussehen und welche Rolle wird sie spielen? Oder hast du vielleicht sogar schon eine Geschichte, eine Story, für die du eine Figur schaffen möchtest? Notiere dir drei Adjektive, die deine Spielfigur charakterisieren. Deine Papierfigur gestaltest du als Collage aus verschiedenen Abbildungen und Materialien.Du brauchst:• Alte Illustrierte, Flyer, Postkarten - alles, was in die Papiertonne müsste• Eine normal große Schere und noch eine zweite, kleinere Schere• Klebstoff, am besten einen Klebestift• Ein festeres Papier, z. B. Fotokarton, oder alte Verpackungen, z. B. eine Müslischachtel• Buntstifte• Weiteres Recyclingmaterial zum Gestalten und Verzieren• eventuell einen Schaschlikspieß und ein Kreppklebeband Und so geht’s:Suche in alten Zeitschriften, Prospekten, Postkarten usw. verschiedene Abbildungen von Menschen und schneide sie aus: kleine, große, dünne, schicke, sportliche, … - je unterschiedlicher, desto besser. Tiere und Gegenstände sind ebenfalls gut geeignet. Achte darauf, dass die Bilder nicht zu klein sind, da du immer nur einen Teil der Figur verwendest. Aus den Abbildungen die einzelnen Gliedmaßen - wie Kopf, Arme, Bauch, Hände oder auch weitere Details wie Füße oder Nase - ausschneiden Dann versuche daraus eine Figur zu legen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Ein kugeliger Gegenstand wird zum Bauch, eine Giraffe liefert den Hals, der Kopf gehört einer Frau, die Nase einem Ameisenbär usw. Probiere mehrere Varianten aus. Wenn du eine Figur geschaffen hast, die dir gefällt, klebe die Einzelteile auf einen festen Fotokarton auf. Alternativ kannst du dafür auch alte Verpackungen wie etwa Müslischachteln verwenden. Fehlt noch etwas? Dann male doch noch weitere Details dazu und schneide deine Figur anschließend aus. Du kannst sie mit weiteren Materialien, z. B. mit alten Geschenkbändern, Zitronennetzen oder Perlen, ausgestalten. Das Spiel mit der Figur Ob du deine Papierfigur nun mit einem Finger spielst oder mithilfe eines Stäbchens als Stabfigur, hängt von deiner Kulisse ab. Bei einer Schuhschachtelkulisse z. B., die eine Rückwand hat, kannst du die Figur nur mit einem Stab von oben führen. Bei einer hinten offenen Kulisse kannst du die Figur auch als Fingerspielfigur gestalten.Fingerspielfigur:Schneide dazu ein kleines Loch – z. B. für den Zeigefinger oder den kleinen Finger - in die Figur. Das Fingerloch kann der Bauchnabel oder die Zunge sein. Tiefer als auf Höhe des Bauchnabels sollte das Fingerspielloch nicht ausgeschnitten werden, sonst verliert die Figur das Gleichgewicht! Du kannst offen auf einem Tisch spielen oder auch verdeckt hinter einer Leinwand, dann entsteht ein Schattentheater. Fingerspielfigur Collage. © Museumspädagogisches Zentrum Stabfigur:Für eine Stabfigur benötigst du noch ein Holzstäbchen, z. B. einen Schaschlikspieß, und ein Klebeband zum Befestigen des Holzstäbchens an der Figur. Den Stab etwa in der Körpermitte festkleben. Er zeigt entweder nach oben oder nach unten - je nachdem, ob du die Figur von oben oder von unten führen möchtest. Das hängt von deiner Kulisse ab. Passender Beitrag auf XponatFigurenspiel, CollagePassende MPZ-FührungSo ein Theater mit dem Schatten – Schattentheater und Puppenspiel im Museum und hinter der Bühne (GS, FöS, Horte)Informationen zum Museum Im Münchner Stadtmuseum kannst du dir die verschiedensten Dauerausstellungen ansehen, darunter auch die Sammlung Puppentheater/Schaustellerei. Abbildungsnachweis Titelbild: Thomas Theodor Heine, „Ein „11 Scharfrichter“-Abend am Mittwoch 15. Juni 1927“ (Ausschnitt), 1927. © Münchner Stadtmuseum
Ein UFO in der Stadt? Auf der Wiese vor der Pinakothek der Moderne findest du das FUTURO – ein „Tiny House“, wie wir es heute nennen würden. Der finnische Architekt Matti Suuronen entwarf dieses mobile Kunststoffhaus ursprünglich als Skihütte, komplett ausgestattet mit Küche, Bad, Schlaf- und Wohnraum, und schnell elektrisch beheizbar. Kaum zu glauben, dass das FUTURO schon über 50 Jahre alt ist! Die Zukunftsvision für mobiles Wohnen, die Matti Suuronen hier in den 1960er Jahren verwirklichte, besitzt auch heute noch Aktualität! FUTURO ist seriell produzierbar, bietet funktionales und zugleich komfortables Wohnen auf einer Fläche von (nur) 25m², ist gut isoliert, und der Auf- oder Abbau aus 16 Bogensegmenten gelingt in nur zwei Tagen. Durch den Stahlrohrrahmen, auf dem das Kunststoffgehäuse aufliegt, ist es für jedes Gelände geeignet und hält sogar Erdbeben und Stürmen stand.Das Münchner FUTURO Haus, das du dir zu bestimmten Zeiten (wann genau, erfährst du HIER) auch von innen ansehen kannst, ist bis auf eine umlaufende Bank leer. Wie könnte eine nach heutigen Maßstäben zukunftsweisende Möblierung aussehen? Nachhaltigkeit ist das Thema unserer Zeit, und viele Designerinnen und Designer liefern hier spannende Ideen. Schau dir unsere Auswahl aus dem reichen Bestand der Neuen Sammlung – The Design Museum an. Schiebe den Regler unter dem Bild von links nach rechts und erfahre mehr zu diesen Objekten: Deine Meinung ist gefragt! Hast du andere Vorschläge oder Ideen für zukunftsweisende Produkte oder Themen, um die sich Designer*innen deiner Meinung nach kümmern sollten? Trage deine Ideen hier in unserer Wortwolke ein. Wenn Vorschläge öfter genannt werden, erscheinen sie entsprechend größer. Du kannst auch mit deiner Handykamera diesen Code scannen! Robotic und KI Ein spannendes Zukunftsthema ist auch die Robotic und die KI, die Künstliche Intelligenz. Dazu stellen wir dir den Roboterassistenten „GARMI“ vor, der an der Munich School of Robotics and Machine Intelligence (MSRM) der Technischen Universität München (TUM) entwickelt wurde. Diese fünf Bilder geben dir einen Einblick, wo GARMI überall eingesetzt wird: Wenn du mehr zu GARMI erfahren willst, schau dir diesen kurzen Film an. Softwaretools und Architektur Welchen Einfluss Computer auf unsere gebaute Umwelt – die Architektur also – haben, zeigte die Sonderausstellung Die Architekturmaschine des Architekturmuseums der TUM, die du auch online besuchen kannst. Computer werden für den Entwurf oder die Berechnung komplizierter Tragwerke genutzt. Sie sind aber auch ein Medium, um Entwürfe zu präsentieren, sie zu erklären und zu bewerben. Mehr dazu findest du HIER. Doch wo geht die Reise noch hin? Zeitreise Reise in die Zukunft und stell dir vor, dein Zuhause wäre mit nachhaltigen Möbeln ausgestattet. Und jetzt kommen noch digitale Medien und künstliche Intelligenz (KI) dazu: Du sitzt in deinem Zimmer und steuerst mit Sprache oder Gesten … Was würdest du dir wünschen? Einen Roboter, der dir Getränke bringt, während du Hausaufgaben machst? Urlaubsbilder, die an die Wand projiziert werden? Den Film deiner Wünsche oder das, was du für Schule, Berufsausbildung oder Studium lernen musst, aufbereitet als Augmented Reality (AR), als erweiterte Realität, die computergenerierte Informationen einblendet?Brauchst du dein Handy überhaupt noch? Und wie würde das die Ausstattung deines Zimmers verändern? Lass dich von Keiichi Matsudas Video Hyper-Reality inspirieren. Keiichi Matsuda, Hyper-Reality, 2016. © Keiichi Matsuda – zu sehen in der Sonderausstellung „Die Architekturmaschine“ des Architekturmuseums der TUM Begib dich in Gedanken auf die Straße und überleg dir, wie die Häuser aussehen würden, wären sie mit all den bunten Bildern deiner Vorstellungen überlagert. Zeichne ein Bild dieser Welt und teile es, wenn du magst, via Facebook oder Instagram. Verwende den Hashtag #MPZzukunft. Nachhaltigkeit Möchtest du mehr erfahren zum Thema Nachhaltigkeit? Dann kannst du dich hier über die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN informieren oder deinen ökologischen Fußabdruck bestimmen. Informationen zu StudiengängenInteressieren dich Design, Architektur, Robotic und KI? Dann informiere dich über Zugangsvoraussetzungen und Studiengänge an Universitäten und Hochschulen. Einige Beispiele erhältst du über diese Links:MSRM, Architektur Bachelore of Arts, Master Robotics, Cognition, Intelligence, Bachelor of Engineering - Robotik, Bachelor Architektur, Bachelor of Arts Design MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Nachhaltigkeit – unsere Spuren auf der Erde (BS, GYM, MS, RS)MusPad: Design – Form, Funktion, Fantasie, Future (GS ab Jgst. 3, MS, RS, GYM, BS) Passende MPZ-FührungenFokus Nachhaltigkeit: Designobjekte in der Diskussion (GS ab Jgst. 3, MS, RS, GYM, BS)Nachhaltig bauen (GS ab Jgst. 3, MS, RS, GYM, BS)Architekturmuseum aktuell (MS, RS, GS ab Jgst. 3, GYM, Horte, BS) Informationen zu den MuseenDie Neue Sammlung – The Design Museum präsentiert den neuen Ausstellungsbereich X-D-E-P-O-T seit September 2021 und zeigt von 16.07.2021 bis 18.09.2022 eine spannende Ausstellung zu KI und Robotic mit interaktivem Laboratorium in der Pinakothek der Moderne.Das Architekturmuseum der TUM hat eine umfangreiche Sammlung zur Architektur vom 16. Jahrhundert bis heute. Die Ausstellungen zu wechselnden Themen werden jeweils in der Pinakothek der Moderne präsentiert. Abbildungsnachweis Titelbild: Matti Suuronen, FUTURO Haus (Ausschnitt), 1965/68. © Die Neue Sammlung – The Design Museum, Foto: A. Laurenzo
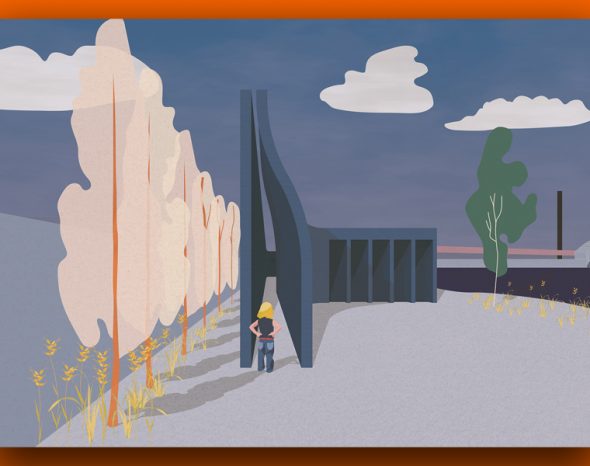
Architektur will gebaut, Architekturwettbewerbe wollen gewonnen werden. Um erfolgreich zu sein, müssen Architekt*innen ihre Ideen gut präsentieren. Immer häufiger sind hier auch Softwaretools im Einsatz. Und Storytelling als Methode. Jana Čulek, Hilma af Klint Museum. A Temple for the Pictures, 2017. © Jana Čulek / Studio Fabula – zu sehen in der Sonderausstellung „Die Architekturmaschine“ des Architekturmuseums der TUM Auf den ersten Blick wirkt das Bild wie ein abstraktes Gemälde oder eine Collage. Es zeigt eine stark abstrahierte Landschaft, ein Gebäude im Zentrum, davor eine blonde Frau in Jeans als Rückenfigur. Der blaue Himmel mit ein paar weißen Wolken, das ärmellose Oberteil der Frau, die Schatten der Bäume, die einen hohen Sonnenstand vermuten lassen, vermitteln eine positive Stimmung. Die Reihe schlanker Bäume links, dazu zarte Gräser lassen an wunderbare Spaziergänge erinnern. Die Atmosphäre scheint fast wichtiger als das Gebäude, um das es geht. So funktioniert Storytelling in der Architektur.Entstanden ist das Bild im Rahmen eines Architekturwettbewerbs für einen Museumsbau – ein Museum zu Ehren der schwedischen Malerin Hilma af Klint (1862 – 1944). Es erzählt gewissermaßen eine Geschichte, die gute Laune macht, ist aber auch Teil des Entwurfsprozesses. Die kroatische Architektin Jana Čulek verwendete dazu Software, die speziell für das Ingenieurwesen entwickelt wurde, ebenso wie handelsübliche Tools für Grafik und Bildbearbeitung. Inspiration für die Gestaltung fand sie in den Gemälden von Hilma af Klint.Drei weitere Bilder ergänzen die Darstellung des Entwurfs.Übrigens: Werke von Hilma af Klint waren im Winter 2018/2019 in der Sonderausstellung Weltempfänger im Kunstbau des Lenbachhauses zu sehen. Probiere es selbst einmal! Entwirf mit kostenfreien Softwaretools ein Haus – vielleicht zu Ehren deiner Lieblingskünstlerin / deines Lieblingskünstlers – und erzähle in deinem Entwurf eine kleine Story! Erzähle von glücklichen Momenten und fröhlichen Menschen, die dieses Haus besuchen.TIPP: 3D-Objekte lassen sich nicht nur mit teurer Software für Profis entwerfen. Kostenfrei geht es z. B. mit der Open-Source-Lösung blender. Oder fertige deinen Entwurf als Collage aus farbigen Papieren an! Fotografiere die fertige Collage und bearbeite das Foto vielleicht auch noch mit einem digitalen Bildbearbeitungsprogramm. Architektur und Computer Was haben Computer und Architektur sonst noch miteinander zu tun? - Eine ganze Menge! Erkunde einige Beziehungen in der 2021 gezeigten Ausstellung „Die Architekturmaschine“ des Architekturmuseums der TUM online von zuhause aus! Passende MPZ-Führung Architekturmuseum aktuell (MS, RS, GS ab Jgst. 3, GYM, Horte, BS)Informationen zum Museum2021 zeigte das Architekturmuseum der TUM die Ausstellung Die Architekturmaschine. Einen Einblick in die Ausstellung bieten ein digitaler Rundgang in englischer Sprache sowie der Audioguide. Abbildungsnachweis Titelbild: Jana Čulek, Hilma af Klint Museum. A Temple for the Pictures, 2017. © Jana Čulek / Studio Fabula – zu sehen in der Sonderausstellung „Die Architekturmaschine“ des Architekturmuseums der TUM

In unserer Reihe #MPZtierisch erfährst du digital tierisch viel über große und kleine, gefährliche und zahme, farbenfrohe und fantastische Tiere ... Geh der Frage nach, zu welcher Gelegenheit man sich als Tier verkleidet. Oder hast du schon mal eine gelbe Kuh gesehen? Und wie siehts mit Drachen aus? Was denkst du ist ein Wolpertinger? Und was war jetzt zu erst da, das Huhn oder das Ei? Folgt uns auf Facebook oder Instagram! Dort werden wir auch alle neuen Aktionen verlinken. Wenn ihr uns eure Kunstwerke zeigen wollt, verwendet den Hashtag #MPZtierisch. TIERISCH ... WILDE MISCHUNGEN TIERISCH ... MASKEN TIERISCH ... VON KLEINEN UND GROßEN HUNDEN TIERISCH ... HENNE, HAHN, EI TIERISCH ... DRACHEN SUCHE TIERISCH ... TRETMÜHLE UND HAMSTERRAD TIERISCH - LEUCHTEND - BUNT Abbildungsnachweis Beitragsbilder : 1) Wolpertinger (in Anlehnung an den Feldhasen Albrecht Dürers) von Rainer Zenz - Rainer Zenz, CC BY-SA 3.0, URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=340080, Bearbeitet: Museumspädagogisches Zentrum; 2) Tuch, sogenannter Tipi-Liner (Ausschnitt), Baumwolle, Aquarellfarben, bemalt mit Heldentaten eines Kriegers, Plains, North Dacota, Standing Rock Reservation, um 1880, Sammlung Prinzessin Therese von Bayern. © Museum Fünf Kontinente, München. Foto: Swantje Aurum-Mulzer, Bearbeitet: Museumspädagogisches Zentrum; 3) Möpse aus Meißner Porzellan (Bearbeitet), Johann Joachim Kaendler, zwischen 1734 und 1747. © Bayerisches Nationalmuseum, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum; 4) Carl Wilhelm Freiherr von Heideck, Haus in Athen (Ausschnitt), 1838, Leinwand, 69 x 47 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München (nicht ausgestellt), URL: https://www.lenbachhaus.de/entdecken/sammlung-online/detail/haus-in-athen-30016533, CC BY-SA 0.4; 5) Dachreiter (Bearbeitet), China, Shandong, 17. Jh.. © Museum Fünf Kontinente, Foto: Marianne Franke, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum; 6) Johann Adam Klein, Münchner Bierfuhrwerk (Ausschnitt), GM-IIb/115, Münchner Stadtmuseum, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum; 7) Franz Marc, Kühe, rot, grün, gelb, 1911, Öl auf Leinwand, 62 cm x 87,5 cm (Ausschnitt), Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, CC BY-SA 4.0. Bearbeitung: Museumspädagogisches ZentrumAbbildungsnachweis Titelbild: siehe Abbildungsnachweis Beitragsbilder. © Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum
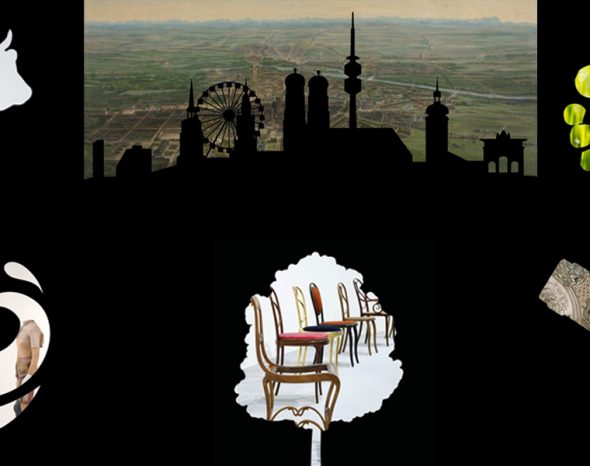
Das MPZ nimmt die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit zum Anlass, das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus zu rücken. Die Plattform MPZ-digital stellt dazu verschiedene Inhalte unter den Rubriken Entdecken und Ausprobieren vor. Lehr- und Erziehungskräfte erhalten hier praktische Impulse zur Umsetzung mit Kindern und Jugendlichen. Auch Familien können Angebote nutzen, um sich gemeinsam spielerisch mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.Mitmachen kannst du von Zuhause aus, oder wo immer du Internetzugang hast. Teil deine Ergebnisse auf Facebook oder Instagram und verwende den Hashtag #MPZnachhaltig. Die Beiträge stehen hier zur Verfügung mit jeweils leicht verständlichen Informationen zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen: UNSERE "ZWEITE HAUT" UNSER ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK NACHHALTIGKEIT UND DESIGN? GLAS – NACHHALTIG? UNTERWEGS AUF NACHHALTIGEN SOHLEN MYGREENCITY – WIE GRÜN IST MEINE STADT? Abbildungsnachweis von links nach rechts: 1) Schablone. © Museumspädagogisches Zentrum; Grafik: Fabian Hofmann; Dahinter: Alexandra Bircken, New Model Army (Ausschnitt), 2016, Foto: Haydar Koyupinar, Museum Brandhorst, Bayerische Staatsgemäldesammlungen. © Alexandra Bircken; 2) Schablone und Fotografie Gras. © Museumspädagogisches Zentrum; 3) Schablone. © Museumspädagogisches Zentrum; Blick in die Ausstellung „Thonet & Design“ (Ausschnitt), Foto: Die Neue Sammlung – The Design Museum (A. Laurenzo); 4) Schablone. © Museumspädagogisches Zentrum; Fotografie Saal (Ausschnitt) © Bayerische Schlösserverwaltung; 5) Schablone. © Museumspädagogisches Zentrum; Grafik: Fabian Hofmann; Fotografie dahinter: „Not und Tugend“. Schuhe der Notzeit aus Stroh und Wolle, 1940/45; vegane Sneakers aus Heu bzw. Zunderschwamm (Ausschnitt), THIES 2017. © Münchner Stadtmuseum; 6) Christian Steinicken, Wilhelm von Breitschwert, München aus der Vogelschau, Blick in südöstlicher Richtung (Ausschnitt), um 1880. © Münchner Stadtmuseum Abbildungsnachweis Titelbild: siehe Abbildungsnachweis Bildgalerie Beitrag, Bearbeitung: © Museumspädagogisches Zentrum, München
Vielleicht bist du dieser lustigen Figur schon einmal auf den Münchner Straßen begegnet? Sie heißt „Münchner Kindl“ und ist auch im Stadtwappen von München zu sehen. Dort ist aber eigentlich kein Kind abgebildet, sondern ein Mönch - also ein Mann, der zur Kirche gehört. Stadtwappen München. © Münchner Stadtmuseum Woran erkennst du, dass das Bild kein Kind, sondern einen Mönch zeigt?Genau! – An der Kleidung!Den weiten Mantel mit Kapuze nennt man eine „Kutte“. Früher sah das Wappen zwar etwas anders aus. Aber der Mönch war schon immer darauf zu sehen. Altes Stadtwappen München. © Münchner Stadtmuseum Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Mönch in der Darstellung zu einem Kind. Damit hatte die Stadt ein besonderes Markenzeichen: Überall in der Welt konnte man sie am „Münchner Kindl“ erkennen! Doch warum ist der Mönch im Wappen?München wird zum ersten Mal in einer Urkunde aus dem Jahr 1158 erwähnt. Gründung-Urkunde der Stadt München. Kollotypie auf Karton (Ausschnitt), um 1888. © Münchner Stadtmuseum Man nennt diese Urkunde den „Augsburger Schied“. Das Wort "Schied" kennst du vielleicht vom "Schiedsrichter" oder der "Schiedsrichterin". Das ist eine Person, die zum Beispiel bei Sportwettkämpfen Entscheidungen trifft. Auch Kaiser Friedrich Barbarossa hat vor langer Zeit eine wichtige Entscheidung getroffen. Es ging damals um einen Streit zwischen Herzog Heinrich dem Löwen und Bischof Otto von Freising. Die Entscheidung ist in der Urkunde festgehalten. Du kannst eine Kopie davon im Münchner Stadtmuseum in der Ausstellung „Typisch München!“ sehen. Willst du mehr zu dem Streit wissen, dann schau dir den Film zur Stadtgründung an. Heute sagen wir zum "Augsburger Schied" auch „Stadtgründungsurkunde“. Einen kleinen Ausschnitt aus dieser Urkunde siehst du in dieser Abbildung. Gründung-Urkunde der Stadt München. Kollotypie auf Karton (Ausschnitt), um 1888. © Münchner Stadtmuseum Hier steht nicht „München“, sondern … - Kannst du es lesen? Schau ganz genau auf die letzten beiden Wörter.„Ap[ud] munich[en]“ steht dort. „Apud“ heißt auf lateinisch „bei“. Was, denkst du, heißt dann „apud munichen“? Klicke die richtige Antwort an. Alter Peter, München. © Museumspädagogisches Zentrum, München Sprich das Wort „Mönch“ und den Namen der Stadt langsam und deutlich nacheinander aus. Fällt dir die Ähnlichkeit auf? Man sagt daher auch: Das ist ein „sprechendes Wappen“, denn der Mönch mit dem Buch in seiner Hand weist direkt auf den Namen des Ortes: „Munichen“ – München. Warum steht das so in der Urkunde?Vor fast 900 Jahren, als die Urkunde entstand, sagten die Menschen: „Wir sind bei den Mönchen“ und meinten damit eine kleine Ansiedlung von Mönchen in der Nähe der Isar. Wir wissen nicht genau, wo sie lag. Sie könnte dort gewesen sein, wo heute die Peterskirche (der „Alte Peter“) steht. Mönche halfen bei Krankheiten mit Heilkräutern und gaben Tipps zum Anbau von Obst und Getreide. Manche konnten auch lesen und schreiben. Sie verkündeten den christlichen Glauben und spendeten Trost. Weil Mönche in der Gegend lebten, wo die Stadt München entstand, ist bis heute ein Mönch im Münchner Wappen zu finden. Bestimmt bist du dem Wappen schon in der Stadt begegnet. Es ist zum Beispiel vorne auf den U-Bahnen und Straßenbahnen zu sehen und auch auf dem Boden, auf manchen Kanaldeckeln. UBahnl. © Museumspädagogisches Zentrum, München Kanaldeckel. © Museumspädagogisches Zentrum, München Münchner-Kindl-Wappen auf der U-Bahn und auf dem Kanaldeckel. © Museumspädagogisches Zentrum, München MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: München entsteht! (GS ab Jgst. 3) Informationen zum MuseumIn der Dauerausstellung „Typisch München!“ im Stadtmuseum München sind dazu wichtige Exponate zu sehen. Du findest sie vor im Moriskensaal. Abbildungsnachweise Titelbild: Kanaldeckel. © Museumspädagogisches Zentrum, München
Auf dem Bild siehst du Modelle von verschiedenen Körperzellen. Die Modelle stehen im Deutschen Museum und sind 25000-fach vergrößert. Damit du dir das besser vorstellen kannst: Ein Mensch, der so große Zellen hätte, wäre 50 km lang! Menschliche Nervenzelle (Modellbau), um 2000, Archiv, CD_L_7207_03. © Deutsches Museum, München Erkennst du die Nervenzelle? Die Nervenzelle ist die langgestreckte grüne Zelle. Manche Nervenzellen werden tatsächlich bis zu 1m lang. Sie ziehen sich durch den ganzen Körper. Die meisten Nervenzellen befinden sich im Gehirn. Diese sind sehr kurz, sonst hätten die etwa neun Milliarden Zellen auch nicht genügend Platz im Kopf. Nervenzellen sind untereinander verbunden durch die sogenannten Synapsen. Wenn wir etwas lernen, bilden sich neue Synapsen, also neue Verknüpfungen von einer Nervenzelle zu einer anderen Nervenzelle, zu einer Sinneszelle oder zu einer Muskelzelle. – Wie z.B. beim Kleinkind, wenn es beginnt, die Sprache zu verstehen, wenn es lernt, dass alle Dinge nach unten fallen oder wie ein Fuß vor den anderen gesetzt wird, um zu gehen. Aber auch beim Erwachsenen bilden sich neue Synapsen, wenn er sich die Gesichter neuer Bekannter merkt oder das Passwort für den Computer. Leicht lernen und vergessen – wie geht das? Wir lernen leichter, wenn wir uns wohlfühlen. Und es kommt beim Lernen natürlich darauf an, wie wichtig uns eine neue Information ist. Wer erinnert sich schon daran, welche Farbe die Autos hatten, die an einem vorbeigefahren sind? Obwohl die Augen die Information aufgenommen haben, haben wir sie nicht gespeichertWenn sich Synapsen wieder lösen, vergessen wir das Gelernte. Deshalb muss man Vokabeln und Formeln so oft wiederholen. Denn bei jeder Wiederholung verstärken sich die Synapsen, und die Vokabeln und Formeln werden langfristig im Gedächtnis gespeichert. Üben und Wiederholen lohnt sich also, auch wenn es mühsam ist!Trainieren und wiederholen ist auch wichtig für Tätigkeiten, die Schnelligkeit und möglichst rasche Reaktionen erfordern, wie das Auffangen oder Abwehren eines Balles, der auf ein Tor geschossen wird. Reaktionsspiel "Glanzparade“. © FC Bayern München AG, Foto: Bernd Ducke Wie schnell laufen die Signale durch den Körper? Die Nervenzellen sind nicht nur untereinander, sondern auch mit den Sinnes- und Muskelzellen verbunden. So kommen Signale von Ohr, Auge oder der Haut zum Gehirn und von dort zur Hand oder zum Bein. Und das mit einer Geschwindigkeit von etwa 350 km/h! – So schnell wie ein ICE, der mit Höchstgeschwindigkeit fährt. Test 1: Wo hast du die meisten Nerven? © Museumspädagogisches Zentrum, München Du brauchst:- einen Partner oder eine Partnerin- zwei Holzstäbchen, z.B. Zahnstocher oder Streichhölzer Drücke nacheinander mit einem Holzstäbchen oder mit zwei Stäbchen gleichzeitig auf den Rücken des Partners. Wenn du mit zwei Stäbchen direkt drückst, dann in verschiedenen Abständen von 5 mm bis 5 cm. Frage jedes Mal, wie viele Druckpunkte dein Partner spürt. Einen oder zwei?Anschließend drückst du in verschiedenen Abständen zuerst auf die Handinnenfläche, dann auf die Fingerspitzen. Danach wechselt ihr die Rollen.Die Frage ist jetzt: Bei welchem Abstand der Stäbchen spürst du zwei Druckpunkte? Muss der Abstand am Rücken größer oder kleiner sein als an der Hand, um zwei Druckpunkte zu spüren? Und was bedeutet das? Wo liegen am meisten Nerven unter der Haut? Ergebnis: Am Rücken werden erst ab einem Abstand von etwa 2 - 3 cm zwei Druckpunkte wahrgenommen. Wenn der Abstand zwischen den Stäbchen kleiner ist, spürt man nur einen Druckpunkt. An den Handinnenflächen spürt man ab etwa 5 mm Abstand zwei Druckpunkte, an den Fingerspitzen schon ab etwa 2 mm. Das bedeutet, dass die Nervenzellen am Rücken weiter voneinander entfernt liegen als an den Händen und den Fingerspitzen. © Museumspädagogisches Zentrum, München Test 2: Wie schnell reagierst du? Du brauchst: - einen Partner oder eine Partnerin- ein Lineal, 30 cm lang Teste deine Reaktionsgeschwindigkeit:Dein Partner hält die Hände so, als wolle er klatschen. Lass nun das Lineal zwischen den Händen deines Partners durchfallen, so wie du es auf dem Foto siehst. Dein Partner versucht, das Lineal möglichst schnell aufzufangen. Bei jedem Versuch lest ihr die Auffanghöhe am Lineal ab. Ergebnis: Nach mehreren Versuchen erhöht sich die Reaktionsgeschwindigkeit. Das Gehirn hat gelernt, die Bewegung schneller auszuführen. Die Reaktionsgeschwindigkeit lässt sich also trainieren. Je öfter du eine Bewegung übst, desto schneller und geschickter kannst du sie durchführen. Wenn die Signale langsamer werden … Wenn wir jedoch müde sind, werden die Signale nur noch langsam über die Synapsen weitergegeben und die Reaktionsgeschwindigkeit lässt nach. Deshalb gibt es in vielen Berufen eine Pausenpflicht, um Unfälle zu vermeiden. Das ist sehr wichtig, wenn mit Maschinen gearbeitet wird oder Fahrzeuge genutzt werden.Auch durch Alkohol wird die Reaktion langsamer. Alkohol gehört zu den Nervengiften. Ebenso der Stoff Botulin, auch Botox genannt. Er wurde als Medikament gegen Nervenkrankheiten entwickelt, bei denen es zu Verkrampfungen kommt. Im kosmetischen Bereich wird Botox gespritzt, um die Muskeln im Gesicht zu lähmen. Dadurch glättet sich die Haut und Falten sind nicht mehr zu sehen. Aber die Muskeln, die zum Lachen oder Stirnrunzeln bewegt werden müssten, können dann nicht mehr kontrolliert werden. Das Gesicht wirkt wie eine starre Maske. Passender Beitrag auf XponatBiologisches Modell, Untersuchung der Reaktionsgeschwindigkeit, Untersuchung körperlicher Reaktionen Information zum MuseumIm Moment kannst du dir die Modelle in der digitalen Pharmazie-Abteilung ansehen. Derzeit wird die zweite Hälfte des Gebäudes saniert, deswegen ist dieser Bereich seit 29. Juni 2022 geschlossen. Die Modernisierung des Gebäudes soll 2028, zum 125. Jubiläum der Museumsgründung, abgeschlossen sein. Bei einem Besuch im Deutschen Museum entdeckst du viel Neues, lass dich überraschen! Abbildungsnachweis Titelbild: Menschliche Nervenzelle (Modellbau), um 2000, Archiv, CD_L_7207_03. © Deutsches Museum, München
Heute kämpft die ganze Welt gegen ein winziges Virus, das sich „Corona“ nennt. Früher kämpften die Menschen gegen „Drachen“ – zumindest in ihrer Vorstellung, denn von Viren und Bakterien hatten sie noch keine Ahnung. Trotzdem mussten sie Wege finden, mit gefährlichen, ansteckenden Krankheiten fertig zu werden. Hier erfährst du, wie die Münchner Bürgerinnen und Bürger es in der Vergangenheit schafften, manch einen „Drachen“ zu besiegen. – Und warum das für uns hier in Deutschland, aber auch für Menschen auf der ganzen Welt heute noch so wichtig ist … Vielleicht atmest du jetzt erleichtert auf: Krankheiten wie Pest und Cholera sind bei uns in Europa zum Glück längst ausgerottet. Aber am Ende des Films weist Pia darauf hin, dass das nicht in allen Ländern der Fall ist: Wo die medizinische Versorgung, die hygienischen Bedingungen und die Wasserqualität nicht so gut sind, brechen solche Krankheiten auch heute immer wieder aus. Es muss deshalb unser Ziel sein, dass alle Menschen auf der Welt Zugang zu sauberem Wasser und zu medizinischer Versorgung haben – egal wo sie leben. Die Vereinten Nationen haben das auch ganz klar in ihren Nachhaltigkeitszielen formuliert. Für die Umsetzung müssen wir noch sorgen. Dabei können die Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit hier in Europa gemacht haben, sicher helfen. Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mit Erklärungen in leichter Sprache findest du HIER. Passende MPZ-Führung Stadtrundgänge - Geschichte - München im Mittelalter – ein Spaziergang durch andere Zeiten Stadtrundgänge - Geschichte - Die Münchner Stadtbäche Münchner Stadtmuseum - Blick auf das mittelalterliche München – Geschichte(n) im Museum und in der Altstadt Münchner Stadtmuseum - Wohnen, trinken und speisen – wie arme und reiche Münchner Familien früher lebten Münchner Stadtmuseum - Arm und Reich – Lebenswelten des 19. Jahrhunderts Informationen zum MuseumIn der Ausstellung „Typisch München“ im Münchner Stadtmuseum erfährst du mehr über das Alltagsleben in München während der letzten Jahrhunderte. Hier kannst du auch das im Film gezeigte Schnittmodell des Hauses in der Theatinerstraße noch genauer unter die Lupe nehmen. Anmerkung für Lehrkräfte, Museumspädagog*innen und Vermittler*innenAnhand des Films lassen sich - über historische und regionale Aspekte der Krankheits- und Seuchenbekämpfung hinaus – auch aktuelle Bezüge zu den globalen Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der Vereinten Nationen in Hinblick auf sauberes Wasser und Gesundheit herstellen. Es handelt sich konkret um die Ziele 3 (Gesundheit und Wohlergehen), 6 (Sauberes Wasser und Sanitärversorgung) und 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden). Abbildungsnachweis Titelbild: Ausschnitt aus dem Film „Der Kampf gegen die Drachen. Krankheiten und Epidemien in München“. © Museumspädagogisches Zentrum, Film: Zeno Legner, Falk Müller
Wie sieht dein Zimmer aus? Ist es weiß gestrichen oder farbig gestaltet? Oder liebst du Tapeten, vielleicht mit Muster oder eher einfarbig? Um unsere Wohnung zu gestalten, holen wir uns Ideen und Anregungen in Wohnzeitschriften, Tipps zum Stylen im Internet oder in Einrichtungshäusern.Heute bummeln wir durch ein edles „Einrichtungshaus“ der Extraklasse, durch die Residenz von München, genauer durch den Königsbau. Das ist natürlich kein „Einrichtungshaus“, sondern das Stadtschloss der bayerischen Könige. Wir schauen uns dort jedoch keine kunstvollen Möbel oder andere wertvolle Einrichtungsgegenstände an, wie edle Kerzenleuchter, exklusive Porzellanvasen oder glitzernde Kronleuchter. Bei uns geht es um Tapeten – oder vielmehr Wanddekorationen.König Ludwig I. wollte in seinem neuen Königsbau auf keinen Fall altmodische Tapeten, etwa aus Stoff, haben. Er war ein großer Freund des antiken Griechenlands und Italiens. Sein Königsbau sollte an einen italienischen Palast erinnern. Der König und sein Architekt Leo von Klenze haben sogar Reisen nach Italien, etwa nach Pompeji, unternommen, um sich dort von den Wandmalereien inspirieren zu lassen.Leo von Klenze entwarf daher eine Raumgestaltung, bei der die Wände mit gemalter Architektur, Wandbildern und ornamentalen Mustern geschmückt wurden. Die Wandbilder erzählen Geschichten von griechischen und deutschen Schriftstellern. Die Architektur wie auch die Bilder sind mit unterschiedlichen Ornamenten – wie etwa Blattranken, Fabelwesen und Blütenmustern – verziert und eingerahmt. Im wunderbaren Salon der Königin Therese kannst du das gut erkennen. Zarte Blattranken umschlingen die zierlich gemalten Säulchen. Ranken, die sich zu kleinen spiralförmigen Kreisen formen, rahmen die Bilder. Wir nennen diese Ranken aus Spiralen Volutenranken. Wenn du genau hinschaust, entdeckst du weitere Motive, zum Beispiel kleine Engel auf Blattgirlanden, Fabeltiere und Maskengesichter. Im Ankleide- und Schlafzimmer des Königs sind die Volutenranken besonders gut zu sehen. Der Beginn und Abschluss der Ranken wird oft durch besondere Motive, etwa durch einen Greif oder ein anderes Fabelwesen, betont. Manchmal ist auch die Rankenmitte hervorgehoben. Oftmals wiederholen sich die einzelnen Motive und ergeben eine gleichmäßige Abfolge, die dann Musterrapport heißt. Volutenranken rahmen die farbigen Wandflächen Volutenranken mit Greif und geflügeltem Mischwesen, Blattgirlanden und Musterrapporte zieren die Wände von links nach rechts: Schlafzimmer des Königs Ludwig I., Detail und Ankleidezimmer des Königs Ludwig I., Detail. © Bayerische Schlösserverwaltung Und wie könnte dein Muster aussehen? Schau dir die Bilder genau an und suche dir zwei Lieblingsmotive aus. Am besten nimmst du Bleistift und Papier und zeichnest die Motive ab. Oder du entwirfst eigene Pflanzenornamente. Dazu kannst du im Frühling auch in einen Park gehen oder in den Botanischen Garten. Auch Leo von Klenze hat zunächst auf Musterblättern vorgezeichnet. Das Motiv, das er am häufigsten verwendete, war die Palmette, die an ein Palmblatt der Fächerpalme erinnert. Ein anderes beliebtes Motiv ist der Lotos, der seinen Ursprung in der Lotosblüte hat. Beide Ornamente wurden bei einem Musterrapport mit Volutenranken zu einem sogenannten Fries verbunden. Das kannst du bei den folgenden beiden Abbildungen sehen: Auf dem linken Bild ist der Palmetten-Lotos-Fries hellblau und hellgrün gestaltet, auf dem rechten rot und grün. Das rechte Bild zeigt oben außerdem noch eine blaue Volutenranke mit einer hübschen Lotosblüte. Rechts Mitte: Lotos und Palmettenfries in hellblau/grün Leo v. Klenze, Mustersammlung Ornamentik, II. Heft, Tafel XII, München 1823. © Bayerische Schlösserverwaltung Oben: Volutenranke mit Lotosblüte Leo v. Klenze, Mustersammlung Ornamentik, II. Heft, Tafel VI., München 1823. © Bayerische Schlösserverwaltung Und nun kannst du aus deinen Motiven Muster zusammenstellen:Du brauchst:• Bleistift• Buntstifte oder Filzstifte• Lineal• Schere• Schmierpapier für deine Skizzen• DIN-A4-Blatt oder Zeichenblockblatt (du kannst auch farbiges Papier nehmen)Und so geht’s:Wähle dir aus deinen Skizzen zuerst zwei deiner Lieblingsmotive aus. Für einen Musterrapport müssen sich die Motive in einer gleichmäßigen Reihenfolge abwechseln. Am einfachsten ist es, wenn du dazu ein DIN-A4-Blatt in Längsstreifen von 5 cm Breite schneidest. Dann faltest du in einem weiteren Arbeitsschritt den Papierstreifen in ebenfalls 5 cm große quadratische Abschnitte. Nun hast du sechs kleine Quadrate, in die du abwechselnd deine beiden Motive einzeichnest. Überlege dir, wie du die beiden Motive in den Quadraten miteinander verbinden kannst. Eine Ranke eignet sich gut, um deinen Musterrapport zusätzlich zu verzieren und zu gestalten. Für einen längeren Rapport, zum Beispiel aus drei Motiven, nimmst du einfach ein größeres Zeichenpapier. Anstelle von weißem Papier ist auch farbiges Tonpapier möglich. Zum Schluss kannst du deine Musterideen und Rapportstreifen in dein MPZ-Album einkleben. Anleitung Muster. © Museumspädagogisches Zentrum Passender Beitrag auf XponatDetailfocus, ObjektbeschreibungInformationen zum MuseumWenn du das Stadtschloss der Münchner Kurfürst*innen und König*innen entdecken möchtest, dann besuche doch einmal die Münchner Residenz. Im Königsbau von Ludwig I. und Therese kannst du auch den prächtigen Thronsaal und die kostbaren Möbel bewundern. Abbildungsnachweis Titelbild: Residenz München, Salon der Königin Therese (Ausschnitt). © Bayerische Schlösserverwaltung, Bearbeitet: Museumspädagogisches Zentrum
Im Frühling beginnen die Pflanzen zu sprießen und die Obstbäume beginnen zu blühen. Hast du dir einen blühenden Apfelbaum schon einmal genauer angeschaut? Bei vielen Apfelsorten sind die Blütenblätter weiß mit einem Hauch Rosa. Die eigentlichen Blätter des Baumes sind noch nicht in voller Größe entwickelt und leuchten in besonders frischem Grün. Genau davon haben sich vor knapp hundert Jahren auch amerikanische Künstler*innen inspirieren lassen. Sie haben eine Tischlampe erfunden, die tatsächlich an einen blühenden Apfelbaum erinnern soll. Genannt haben sie sie „Apple Blossom“ (Apfelblüte). Seit den 1890er Jahren entwickelte sich ein neuer, moderner Kunststil, der gerne Einflüsse aus der Welt der Pflanzen in die Kunst aufnahm. In Deutschland gab man ihm den Namen „Jugendstil“. Das Bayerische Nationalmuseum hat viele wunderschöne Jugendstilobjekte aus der Zeit um 1900. Unter anderem diese extravagante Lampe. Sie wurde in New York hergestellt und war um 1900 sehr beliebt und sehr teuer. Mit Sicherheit hast du erkannt, dass die Lampe einem Baum nachempfunden ist. Der Lampenfuß aus Bronze ist wie ein Baumstamm mit Wurzeln und Rinde gestaltet, der Lampenschirm aus unterschiedlich farbigem Glas erinnert an die Krone eines blühenden Apfelbaums. Die einzelnen kleinen Glasscheiben sind mit Hilfe von Metallstegen miteinander verbunden. - Ein herrlicher Miniatur-Apfelbaum, den man auf ein Beistelltischchen oder eine Kommode stellen kann!Besonders schön ist die Lichtwirkung durch das unterschiedlich farbige Glas. Mit einfachen Mitteln kannst du die Glastechnik z.B. für ein kleines Fensterbild nachahmen. Dazu benötigst du: • einen dünnen Karton oder Tonpapier in DIN A5 (es darf nicht lichtdurchlässig sein)• Transparentpapier• Schere• Kleber• Schmierpapier für deine Skizzen Bastelmaterialien Kleines Fensterbild Materialvorlage und kleines Fensterbild. © Museumspädagogisches Zentrum Und so geht´s:Skizziere auf einem extra Blatt Papier deine Blumen oder Blätter, die du in das „Fenster“ einfügen willst. Nimm dazu Vorbilder aus der Natur oder gestalte Phantasieblumen. Das Skizzenblatt kann später Teil deines MPZ-Album werdenÜberlege dir, wie groß dein Motiv werden soll, damit es gut auf deinen Karton passt.Zeichne auf den Karton oder das Tonpapier eine Fläche auf. Achte dabei darauf, dass ein Rand von ca. 1 – 1,5 cm stehen bleibt: der spätere „Fensterrahmen.“ Anschließend schneidest du die vorgezeichnete Fläche aus, am besten mit einer kleinen spitzen Schere. Dann schneidest du ein weißes Transparentpapier in DIN-A5-Format aus, um es später auf den Fensterrahmen aus Karton/Tonpapier aufkleben zu können.Nun schneidest du aus unterschiedlich farbigem Transparentpapier die Blütenblätter, Stängel und Blätter entsprechend deiner Skizze aus und klebst sie auf das weiße „Fenster“ auf. Um die Wirkung der dunklen Metallstege wie bei der Lampe zu erhalten, kannst du zum Schluss noch mit einem dicken schwarzen Filzstift die einzelnen farbigen Blattschnipsel umranden.Klebe oder hänge dein Kunstwerk an ein Fenster und du wirst einen ähnlichen Effekt erzielen wie bei der „Apple Blossom“-Lampe. Zum Schluss kannst du dein Kunstwerk in dein MPZ-Album einkleben. Informationen zum MuseumDie hier vorgestellte Lampe findest du im Bayerischen Nationalmuseum. Abbildungsnachweis Titelbild: Tischlampe „Apple Blossom“, Ausführung: Tiffany Studios New York, um 1902-1906. © Bayerisches Nationalmuseum München, Bearbeitet: Museumspädagogisches Zentrum
Bei einem Spaziergang im Wald und über Wiesen kannst du schon im Frühling viele Pflanzen entdecken, die auch unter Bäumen blühen. Krokusse, Schlüsselblumen, Tulpen und Narzissen, die du vielleicht als Osterglocken kennst. So früh im Jahr fällt für die ersten Pflanzen noch genügend Licht auf den Boden, denn die Bäume haben noch keine Laubblätter und werfen kaum Schatten. Krokusse. © Botanischer Garten München-Nymphenburg Schlüsselblume. © Museumspädagogisches Zentrum Narzisse. © Museumspädagogisches Zentrum Schneeglöckchen. © Museumspädagogisches Zentrum Aber es ist kalt und der Boden ist oft noch gefroren. Wie schaffen es diese Pflanzen, trotzdem zu wachsen? Schneeglöckchen, Narzissen und Tulpen können das mit Hilfe ihrer unterirdischen Zwiebeln. Diese Zwiebeln sind keine Wurzeln, sondern besondere, eng aneinander liegende Blätter, sogenannte Speicherblätter. Sie enthalten genügend Nährstoffe und Wasser, damit die Pflanze austreiben kann. Deshalb können Speisezwiebeln auch in der Küchenschublade grüne Triebe ausbilden, wenn ab und zu Licht hineinfällt. Das hast du sicher schon mal gesehen. Speisezwiebeln. © Museumspädagogisches Zentrum Schauen wir wieder nach draußen. Beim Blick auf eine sonnige Wiese fällt auf, dass die vielen Blüten am Morgen aufgehen und sich am Abend schließen. Wie machen die Pflanzen das? Wie bewegen sie ihre Blätter? Blütenfelder. © Botanischer Garten München-Nymphenburg Am Beispiel einer Tulpe wollen wir uns das mal genauer anschauen.In vielen Läden gibt es jetzt Tulpen in verschiedenen Farben und Formen, auch aus fairem Handel. Hole dir zwei frische Tulpen - vielleicht gibt es in deiner Nähe sogar ein Feld zum Selberpflücken - und stelle sie in eine Vase. Dann kannst du jeden Tag beobachten, wie die Blüten morgens aufgehen und wie sie sich am Abend wieder schließen.Wie bewegen die Tulpen ihre Blütenblätter? Das funktioniert so: Damit die Blüte aufgeht, wächst die Schicht auf der Innenseite der Blütenblätter. Dadurch wird die Innenseite länger und die Blätter biegen sich nach außen. Am Abend wächst die Schicht auf der Außenseite der Blütenblätter und sie biegen sich nach innen. Die Bewegungen, die dadurch entstehen, nennt man Wachstumsbewegungen. Du kannst den Längenzuwachs mit einem Lineal messen. Hier kannst du die Versuchsanleitung ausdrucken - klick dazu auf das Bild. Versuchsanleitung. © Museumspädagogisches Zentrum Wenn du die Versuchsanleitung ausgedruckt hast, schneide das DIN-A4-Blatt an der gestrichelten Linie durch und hefte die beiden DIN-A5-Seiten in dein MPZ-Album. Dann kannst du täglich deine Messungen machen und die Werte hier eintragen. Fotografiere die Tulpen am ersten und am letzten Tag des Versuchs und teile die Fotos auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag #MPZblätter. Schreib auch dazu, wie viele Millimeter die Blütenblätter gewachsen sind. Sehen die Blätter am Ende des Versuchs anders aus? Würdest du solche Tulpen noch verschenken? Schmuckhof des Botanischen Gartens. © Botanischer Garten München-Nymphenburg Passende MPZ FührungenFrühblüher (GS, MS, RS, FöS, GYM, BS, Horte)Die Wiese (GS, MS, RS, FöS, GYM, BS, Horte)Was brauchen Honigbienen und ihre wilden Verwandten? (GS, FöS, Horte) Informationen zum MuseumBei einem Besuch im Botanischen Garten München-Nymphenburg kannst du im Frühling viele Pflanzen mit ausgefallenen Formen und Farben entdecken. Der Botanische Garten gehört mit 21,20 Hektar Fläche und 19.600 Arten und Unterarten zu den bedeutendsten Botanischen Gärten der Welt. HIER kannst du dir anschauen, was es sonst noch im Botanischen Garten zu sehen gibt. Abbildungsnachweis Titelbild: Blütenfeld. © Botanischer Garten München-Nymphenburg
Magst du Hunde oder hast du eher Angst vor ihnen? - Keine Angst, die Hunde, die wir dir im Folgenden vorstellen wollen, beißen nicht. Streicheln kannst du sie leider auch nicht, da sich alle im Folgenden gezeigten Hunde in Münchner Museen befinden. Viele würden sich aber bestimmt schön weich und wuschelig anfühlen, während andere ein eher borstiges Fell haben.Gerade in Zeiten von Corona legen sich viele Menschen ein Haustier zu. Deutschlandweit leben gegenwärtig über neun Millionen bellende Vierbeiner, Tendenz steigend. Hunde gehören damit zu den beliebtesten Haustieren und sind seit Jahrtausenden Freund und Begleiter des Menschen. Es gibt sogar spezielle Friedhöfe, in denen nur Hunde und andere Haustiere beerdigt werden.Kannst du dir vorstellen, dass es in den Münchner Museen eine Vielzahl an Hunden gibt? Natürlich sind es keine lebenden Hunde, denn die sind in Museen nicht erlaubt. Von der Antike bis zur Moderne - Hunde wurden in der Kunst immer wieder dargestellt: als treue Begleiter auf Porträts, zur Hervorhebung der sozialen Stellung, als Helfer bei der Jagd oder als eigenständige, zentrale Motive. Auch Spielzeughunde finden sich in den Beständen der Münchner Museen. Das folgende Memory zeigt dir eine Auswahl an unterschiedlichen „Museums-Hunden“: Hast du dir, wenn du unterwegs bist, schon einmal die unterschiedlichen Hunde genauer angeschaut? Es gibt unglaublich viele verschiedene Hunde: kleine und große, reinrassige und sogenannte Promenadenmischungen, folgsame und unfolgsame, leise und laute, freche und bissige … Weltweit gibt es heute etwa 800 Hunderassen. Welche kennst du? Fallen dir 10 verschiedene ein?Hunde teilen über ihre Körpersprache und ihre lautlichen Äußerungen sehr viel über ihre Gefühle und Stimmungen mit. Sie können glücklich, ausgelassen oder aggressiv bellen, knurren oder winseln. Hättest du Lust, den „Museumshunden“ eine Stimme zu geben? Passt ein fipsiges Bellen zu einer Dogge oder ein tiefes Knurren zu einem Mops?Welches Tier soll fröhlich, welches eher ärgerlich oder drohend klingen? Klicke auf die unterschiedlichen Hundegeräusche und lass dabei deiner Fantasie freien Lauf: Welches Bellen passt am besten zu dem Bild? Informationen zu den MuseenDie hier vorgestellten Hunde stammen aus diesen Museen: Bayerisches Nationalmuseum und Bayerische Staatsgemäldesammlungen. Abbildungsnachweis Titelbild: Möpse aus Meißner Porzellan (Bearbeitet), Johann Joachim Kaendler, zwischen 1734 und 1747. © Bayerisches Nationalmuseum, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum
Was ist ein Mischwesen? Ein Wesen, das Karten mischt? Nein! Ein Wesen, das Getränke mischt? Auch nicht! Es ist ein Wesen, das aus verschiedenen Lebewesen zusammengesetzt ist. Genauer gesagt aus unterschiedlichen Einzelteilen von mehreren Wesen, egal ob Mensch oder Tier. Auch die Eigenschaften dieser Wesen vermischen sich natürlich. In Wirklichkeit gibt es zwar die einzelnen Lebewesen, nicht aber die wilden Mischungen. Die Fantasie der Menschen hat sie geschaffen.Du kannst jetzt berühmte Mischwesen entdecken. Los geht’s! Was ist hier vermischt? Im Memo-Spiel lernst du verschiedene Mischwesen kennen. Im zweiten Spiel kannst du die Mischwesen der richtigen Gruppe zuordnen. Die Sirenen Sirene, CC BY-SA 3.0 DE, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6207487, Foto Sirene von Memphis: Museumspädagogisches Zentrum. Sirenen geben bei Gefahr einen Warnton von sich. Laut und auffällig, damit alle aufmerksam werden. Sirenen gab es auch schon vor langer Zeit in der griechischen Mythologie. Es handelte sich um Mischwesen aus Frau und Vogel, manchmal auch Frau und Fisch. Sie wohnten auf einer Insel und lenkten mit ihrem bezaubernden Gesang die Schiffsleute ab, die vorbeifuhren. Das konnte sehr gefährlich werden. Hier hörst du eine Sirenen-Geschichte: Tierische Mischungen Jetzt schauen wir uns einmal die tierischen Mischwesen genauer an. Unten findest du einige Tiernamen. Ziehe jeweils eine Gruppe von Tiernamen zum passenden Mischwesen. Eigene wilde Mischungen In einem lustigen Zeichenspiel könnt ihr selbst Mischwesen erfinden. Ihr braucht nur Papier und Bleistift oder Buntstifte. Und so geht’s: Jeder Mitspielende zeichnet einen Tier- oder Menschenkopf auf den oberen Teil des Papiers und faltet das Blatt so, dass nur noch ein Stück Hals sichtbar ist. Dann das Papier zum nächsten Mitspielenden weitergeben. Einen Tier- oder Menschenkörper an den Hals zeichnen und wieder das Papier falten und weitergeben. Der oder die Letzte zeichnet die Beine und Füße und gibt weiter. Danach faltet jeder sein Papier auf. Gebt euren Mischwesen passende Namen: Geweihkängurumann, Affenhasenhuhn oder was eben am besten passt. Viel Spaß mit euren wilden Mischungen! Giraschlawal © Museumspädagogisches Zentrum Passender Beitrag auf XponatWortkarte, Haiku, Erinnern aus dem Gedächtnis Passende MPZ-FührungAntike Mischwesen: Von Faunen, Satyrn und Kentauren Informationen zum MuseumIn diesen Museen findest du die Mischwesen aus diesem Beitrag und noch viele andere „wilde Mischungen“:Museum Fünf Kontinente, Lenbachhaus, Staatliche Antikensammlungen, Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke Abbildungsnachweis Titelbild: Wolpertinger (in Anlehnung an den Feldhasen Albrecht Dürers) von Rainer Zenz - Rainer Zenz, CC BY-SA 3.0, URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=340080, Bearbeitet: Museumspädagogisches Zentrum

Schon immer waren die Menschen bestrebt, sich das Leben durch verschiedene Hilfsmittel zu erleichtern. Unsere Vorfahren begannen vor 10 000 Jahren damit, Wildtiere zu zähmen. Zu den ersten Haustieren gehörten Auerochsen, Wildschafe, Ziegen, Hühner und sogar Wölfe. Nutztiere wurden vielseitig verwendet und dienten dem Menschen zur Erzeugung von Nahrungsmitteln und Gebrauchsgütern wie Leder und Wolle, aber auch als Lasten- und Arbeitstiere. Nun hatten die Menschen nicht nur Tierprodukte zur Verfügung, ohne jagen zu müssen, sondern konnten sogar Tiere zu ihrem Schutz halten. Sie mussten nicht mehr den Herden hinterher ziehen. Sie begannen, von Ackerbau und Viehzucht zu leben. Dies war ein großer Schritt für die Menschheit. Johann Adam Klein, Münchner Bierfuhrwerk, InventarNr. GM-IIb/115Quelle: https://sammlungonline.muenchner-stadtmuseum.de/objekt/muenchner-bierfuhrwerk-10002313.html Über Jahrtausende arbeitete der Mensch ohne technische Hilfsmittel. Viele Tiere haben mehr Kraft als Menschen und können deshalb schwerere Lasten tragen und ziehen. Selbst ein starker Mann würde bei dem Versuch, ein Bierfass über eine längere Strecke zu schleppen, bald zusammenbrechen. Ein Pferdegespann schafft dagegen problemlos ein Dutzend Fässer. Ochsentretscheibe um 1600, Foto: Deutsches Museum München, Archiv BN40255 Auch das Mahlen von Getreide mit handbetriebenen Mahlsteinen und das Schöpfen von Wasser aus Brunnen war zu kräftezehrend für Menschen.Hilfsmittel, um die Muskelkraft zu verstärken, mussten erfunden werden. Durch den Einsatz von Rädern, Hebeln oder Rollen konnten Muskelkraftmaschinen gebaut werden. Die „Tretmühle“ ist eine solche Muskelkraftmaschine. Auf der schräggestellten Tretscheibe arbeiteten ein oder zwei Ochsen. Die Tiere waren am Hals angeseilt und daher gezwungen, ständig weiter zu gehen. Dadurch drehte sich die Scheibe unter ihnen. Ein hölzernes Getriebe übertrug die Drehbewegung auf einen Mühlstein im Inneren des Gebäudes. Auch auf dem Feld mussten die Ochsen sich richtig „ins Zeug legen". Der Begriff „Zeug" bezieht sich dabei auf das Geschirr von Zugochsen, mit dem die Tiere einen Wagen oder einen Pflug hinter sich herzogen, um ein Feld umzugraben. Das berühmte „Hamsterrad“ war ursprünglich ein Hundelaufrad. Der Hund wurde gezwungen, immer weiter zu laufen und so über die Drehbewegung den Blasebalg des Schmieds anzutreiben. Auch der sogenannte „Göpel“ nutzt die Muskelkraft von Pferden oder anderen Zugtieren. Der Göpel ist die einfachste Maschine, mit der die Muskelkraft eines Tieres auf eine Achse übertragen werden kann. Die Muskelkraft des im Kreis laufenden Tieres sorgt für eine Drehbewegung und treibt so z.B. ein Wasserschöpfrad an. Hundetretrad in einer Nagelschmiede, Archiv BN45985 © Deutsches Museum München Durch die Industrialisierung und den Einsatz von Kohle als Energiequelle wurden Tiere wie das Pferd langsam aber sicher arbeitslos. Gleichzeitig entstanden aber auch neue Einsatzbereiche für tierische Helfer, z.B. im Bergbau. Pferd treibt Göpel an, Darstellung eines italienischen Künstlers, ca. 1430 © Deutsches Museum München Bergleute nahmen Tiere mit in die Stollen, damit die sie vor giftigem Gas oder bei Sauerstoffmangel rechtzeitig warnten. In diesem Job war der Kanarienvogel unschlagbar. Wenn der eifrige Sänger aufhörte zu singen oder gar von seiner Stange kippte, stimmte etwas nicht unter Tage. Viele Kanarienvögel wurden so zu Lebensrettern.Das Zusammenleben von Menschen und Nutztieren hatte dadurch eine ganz andere Bedeutung als heute: Das Tier war mehr „wert“! Der Mensch war darauf angewiesen, dass seine Tiere gesund blieben. Sie produzierten genau so viel Energie und Nahrungsmittel, wie die Menschen zum Leben brauchten. Die Art und Weise der Nutztierhaltung hat sich stets weiterentwickelt. Die Anforderungen an die Tiere wurden dabei aber immer höher: Die Hühner mussten immer mehr Eier legen, die Kühe mehr Milch geben und die Schweine schneller wachsen.Die Bedürfnisse der Tiere traten in den Hintergrund. Heutzutage prägt die „Massen-Tierhaltung“ den Umgang mit Nutztieren in der Landwirtschaft. Viele Menschen lehnen inzwischen diese Ausbeutung der Tiere ab. Die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern trägt stärker zum Klimawandel bei als die von pflanzlichen Nahrungsmitteln. Für das Kraftfutter von Nutztieren wird Regenwald abgeholzt, Wiesen werden in Ackerland umgewandelt und Feuchtgebiete trockengelegt. Auch das von Rindern und anderen Wiederkäuern ausgestoßene Klimagas Methan hat negative Auswirkungen auf unser Klima. Und Gülle und Medikamente aus der Tierhaltung verschmutzen unser Grundwasser. Nachhaltigkeit Werde auch du zum KLIMARETTER! Iss etwas weniger Fleisch und schütze so unsere Umwelt und die Tiere vor Ausbeutung! Die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen, insbesondere SDG 1 und 2, zielen darauf ab, dass alle Menschen dieser Erde Zugang zu ausreichend gesunden Lebensmitteln haben. Dieses Ziel ist direkt mit der Produktion von tierischen Lebensmitteln verknüpft. 17ziele.de Keine Armut: Ein großer Teil der in Deutschland landwirtschaftlich genutzten Fläche dient dem Anbau von Futtermitteln für die Tierhaltung und nicht der direkten Nahrungsmittelproduktion. Das reicht aber immer noch nicht. Millionen Tonnen an Soja als Futtermittel für Schweine, Rinder und Geflügel werden aus Ländern wie Brasilien eingeführt. Dadurch steht der dortigen Bevölkerung weniger Fläche zum Anbau von Nahrungsmitteln zur Verfügung. Hunger und Armut werden verstärkt. 17ziele.de Kein Hunger: Werden Ackerflächen direkt für die menschliche Ernährung genutzt, stehen den Menschen weltweit deutlich mehr Nahrungsmittel zur Verfügung. Durch ein bis zwei fleischfreie Tage pro Woche in den reichen Ländern könnte die Ernährungssituation in den Ländern des Globalen Südens bereits deutlich verbessert werden.Es gäbe weniger Hunger auf der Welt. Informationen zu den MuseenHier findest du mehr Informationen zum Deutschen Museum sowie zum Münchner Stadtmuseum. Abbildungsnachweis Titelbild: Johann Adam Klein, Münchner Bierfuhrwerk (Ausschnitt), GM-IIb/115, Münchner Stadtmuseum, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum

Drachen kennst du vielleicht aus Geschichten oder Filmen. In Wirklichkeit gibt es sie nicht. Es sind Fantasietiere. Schon vor ganz langer Zeit haben die Menschen sie sich ausgedacht. Es gab manches, was die Menschen nicht beherrschen konnten: Feuer und Wasser zum Beispiel, oder Krankheiten und Hungersnöte. Dann stellten sie sich diese Dinge als Drache vor. Und wer einen Drachen zähmen oder besiegen konnte, war besonders tapfer, mutig und stark. In China dagegen gilt der Drache als Zeichen für Glück und Macht. Dort ist er auch ein Tierkreiszeichen. Alle zwölf Jahre gibt es ein Drachenjahr (zuletzt 2012). Auch in den Münchner Museen und an manchen Orten in der Stadt „hausen“ Drachen. Sie warten darauf, entdeckt zu werden. Geh mit auf die Suche! Film "Der Kampf gegen die Drachen. Krankheiten und Epidemien in München" (Ausschnitt). © Museumspädagogisches Zentrum, Film: Zeno Legner, Falk Müller Wassily, Georg und der Drache Der Heilige Georg ist der bekannteste Drachenbekämpfer und wird oft als Ritter in Rüstung dargestellt. Beim Memo-Spiel war er auch auf einem bunten Gemälde dabei. Das Bild stammt von Wassily Kandinsky, einem berühmten russischen Maler. Er wurde 1866 in Moskau geboren, wuchs dort auf und lebte auch lange Zeit in München und Murnau. Auf seinen Bildern ist immer wieder der Heilige Georg zu sehen. Warum wohl? Die Drachen-Karten helfen dir dabei, der Antwort auf die Spur zu kommen. Der Drache und der Blaue Reiter Kandinsky sah also Georg und den Drachen häufig in seinem Leben an verschiedenen Orten. Der Heilige Georg ist in vielen Ländern der Welt bekannt. Sein Zeichen ist eine weiße Fahne mit rotem Kreuz. Das ist die Fahne von England. Viele mächtige Herrscher nahmen sich Georg zum Vorbild. Kannst du dir vorstellen, warum?Kandinsky und seine Kollegen wollten anders malen als die Künstler*innen vor ihnen. Zusammen mit Franz Marc sammelte Kandinsky Bilder und Aufsätze, die ihre Kunst erklären sollten. 1912 erschien diese Sammlung als Buch (Almanach). Die beiden Maler gaben ihm den Titel "Der Blaue Reiter". Franz Marc liebte nämlich Pferde, Kandinsky Reiter. – Und beide liebten die Farbe Blau. Hier siehst du das Titelbild. Wassily Kandinsky hat es entworfen.Was zeigt das Bild? Kannst du etwas erkennen?Schiebe den Regler nach links und es erscheint ein Hinterglasbild von Wassily Kandinsky, welches das gleiche Motiv zeigt. Es wird dir sicher helfen, die einzelnen Elemente auf dem Titelblatt besser erkennen zu können. Welche Einzelheiten, die du auf dem Hinterglasbild siehst, hat Kandinsky auf dem Titelblatt „Der Blaue Reiter“ weggelassen? Du kannst prüfen, ob du richtig liegst. Ziehe einfach die zwei passenden Blasen in die leeren Lösungsblasen. Jetzt kennst du dich schon gut mit Drachen aus und kannst weiter auf die Suche gehen. Tipp: Schau doch mal beim „Wurmeck“ am Münchner Neuen Rathaus vorbei!Du kannst auch selbst fantasievolle Drachen gestalten. Ein paar Anregungen bekommst du hier. – Klicke einfach auf die folgenden Bilder: Drache als Stiftehalter Einen feuerspeienden Drachen basteln MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Vom Haustier bis zum Fabelwesen – Tierdarstellungen in der Kunst (MS, RS, GYM, Jgst. 5 – 11) Passende MPZ-FührungGrüne Nasen, gelbe Kühe und der Blaue Reiter (Horte, Inklusionsklassen, FöS, MS, RS, GS, GYM)Wassily Kandinsky – auf dem Weg der Abstraktion (Horte, MS, RS, GS, GYM)Geflügelte Drachen, zahme Löwen oder die Kuh im "Wohnzimmer". Tiere auf Bildern in der Alten Pinakothek. (Horte, FöS, MS bis Jgst. 6, RS bis Jgst. 6, GS, GYM bis Jgst. 6)Programm für Deutschklassen: Tierische Welten – die Darstellung von Tieren in der Kunst (Deutschklasse MS Jgst. 5-6, Deutschklasse GS,)Glücksdrache aus China und Japan (MS bis Jgst. 7, RS bis Jgst. 7, GS, GYM bis Jgst. 7) Informationen zu den MuseenIn diesen Museen findest du die Drachen: im Münchner Stadtmuseum und in der Online-Sammlung des Münchner Stadtmuseums, im Lenbachhaus, der Staatlichen Münzsammlung, dem Bayerischen Nationalmuseum, dem Museum Fünf Kontinente und dem Schloss Lustheim. Abbildungsnachweis Titelbild: Dachreiter (Bearbeitet), China, Shandong, 17. Jh.. © Museum Fünf Kontinente, Foto: Marianne Franke, Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum
Bunt und bewegt Franz Marc, Kühe, rot, grün, gelb, 1911, Öl auf Leinwand, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, CC BY-SA 4.0 Eine gelbe Kuh!? Irgendwie fröhlich und energiegeladen wirkt sie, wie sie von links ins Bild springt. Dazu ein rotes Kalb und ein grünes Rind – ob männlich oder weiblich, lässt sich schwer sagen. Vielleicht eine Familie? Franz Marc malte die Tiere in einer bunten Umgebung, die die Bildfläche füllt. Dabei verwendete er für Körper und Landschaft vor allem weiche Formen. Er malte die Tiere in ihren typischen Bewegungen und kombinierte verschiedene Körperhaltungen in einem Bild.Als Franz Marc vor über hundert Jahren Tiere in bunten Farben malte, ganz anders also als ihre natürliche Farbgebung wäre, mag das für das Publikum seltsam gewirkt haben. Heute leben wir in einer Welt voller Farben: Spielsachen, Kleidung, Farbfotos, bunte Gegenstände, Werbeplakate … und schätzen Marcs Bilder als wichtigen Schritt auf dem Weg der Abstraktion.Weshalb Franz Marcs Bilder so leuchten, hat einen einfachen Grund: Er wählte Farben, die sich ganz besonders steigern, und kombinierte geschickt. Solche Überlegungen hat er auch schriftlich festgehalten. Zudem setzte er helle Farbflächen neben dunkle, die in die Tiefe gehen. Farbexperimente Probiere es aus! Leg dir eine Farbsammlung an, indem du aus Werbeprospekten, Zeitschriften oder Papierresten einfarbige Farbflächen ausschneidest – möglichst alle im selben Format, z.B. 3 x 3 cm. Oder male verschiedene Farbfelder in diesem Format auf ein Papier (drück dabei fest auf!) und schneide diese aus. Jetzt brauchst du noch einen weißen und einen schwarzen Untergrund. Kombiniere die Farbkärtchen unterschiedlich. Wie bringst du die Farben besonders zum Leuchten? © Museumspädagogisches Zentrum Farbkontraste Treffen helle und dunkle Farben aufeinander, erstrahlt die helle vor der dunklen. Ganz besonders aber leuchten zwei Farben, die sich im Farbkreis gegenüberstehen. Das wird als Komplementärkontrast bezeichnet. Schau dir das Gemälde „Kühe, rot, grün, gelb“ noch einmal genau an! Entdeckst du Stellen, an denen die Komplementärfarben (fast) direkt nebeneinander stehen? Und wo gibt es Hell-Dunkel-Kontraste? Gut getarnt Wassily Kandinsky, Die Kuh, 1910, Öl auf Leinwand, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Gabriele Münter Stiftung, CC BY-SA 4.0 Hast du die Kuh schon entdeckt? Oder vielleicht sogar mehrere Rinder?Im Vergleich zu Marcs Gemälde „Kühe, rot, grün, gelb“ erscheint bei Wassily Kandinsky die gelbe Kuh im Vordergrund ganz anders. Sie ist gut versteckt im Getümmel der Farben und Formen. Farbige Flächen bilden eine Landschaft mit Hügeln und Bergen, wie Kandinsky sie in Oberbayern kennenlernte. Er kombinierte diese aber mit goldenen Kuppeln, die typisch für seine Heimat Russland sind. Mit diesem bunten Hintergrund verschmilzt die Kuh fast. Welche Flächen gehören wohl zur Kuh, welche zur Umgebung? Exotisch bunt? August Macke, Zoologischer Garten I, 1912, Öl auf Leinwand, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, CC BY-SA 4.0 Während Franz Marc Tieren meist die Hauptrolle in seinen Bildern gab, spielen bei August Macke auch Menschen eine wichtige Rolle. Daher überrascht es nicht, dass er Tiere im Zoo malte, wo Menschen Tiere aus fernen Ländern beobachten können, und auch die Besucher mit ins Bild nahm. Offensichtlich faszinierte Macke das bunte Gefieder der Vögel, die dort zu sehen waren: Papageien, Kakadus und Flamingos. Zusammen mit den Büschen, Bäumen, Wasserflächen und Zäunen komponierte er bunte Zoobilder. Hier zog er mit dunkler Farbe Konturlinien, Umrisslinien also, um den Figuren in den ineinander übergehenden Farben eine klare Form zu geben. Deutlich wird das bei den Herren, die allesamt Hüte – sogenannte „Melonen“ – tragen, und bei den beiden Tierköpfen am unteren Bildrand. – Vor allem bei den Ohren der Antilope links. Macke – Marc – Kandinsky Die drei Gemälde von Wassily Kandinsky, Franz Marc und August Macke sind in einem engen Zeitraum entstanden: 1910, 1911 und 1912. 1911 ist das Jahr, in dem Wassily Kandinsky und Franz Marc als Herausgeber und Redakteure an einem Almanach – also einem Jahrbuch – mit dem Titel „Der Blaue Reiter“ arbeiteten. Bereits 1910 hatte Franz Marc August Macke kennengelernt, mit dem ihn eine enge Freundschaft verband.Die Künstler tauschten sich über ihre Ideen aus und entwickelten damit ihre eigene Malweise weiter. Typisch für die Zeit stellten alle drei in ihren Werken die Welt abstrakt dar – nicht realistisch also, wie wir sie kennen.Welches der drei Bilder gefällt dir besonders? Kannst du deine Wahl begründen?Noch mehr Gemälde der drei Künstler findest du im Lenbachhaus. Jetzt bist du dran! Franz Marc, Mandrill, 1913, Aquarell, Tempera, Bleistift, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Dauerleihgabe der Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München, CC BY-SA 4.0 Gestalte ein bunt leuchtendes Bild mit Tieren und FormenDu brauchst:• Ein Blatt weißes Papier, z.B. im Format DIN A5• Farbstifte, Wachsmalkreiden oder andere Farben, mit denen du besonders gerne malst• Ggf. ein Blatt dunkles Papier, das etwa größer ist als das weißeUnd so geht’s:• Welche Tiere möchtest du malen?• Suche dir Fotos als Vorlage, die diese Tiere in bewegter Körperhaltung zeigen.• Entscheide, ob du den Tieren die Hauptrolle geben magst, oder ob du sie lieber im Bild verstecken möchtest, und male die Tiere entsprechend groß.• Zeichne zuerst die Umrisse der Tiere nur schwach.• Überlege, ob runde oder eckige Formen zu diesen Tieren besser passen.• Zeichne entsprechend passende Linien und Formen als Hintergrund.• Fülle das Bild mit bunten Farben, drücke dazu fest auf und lass keine Stelle frei!• Wenn du weiße Stellen im Bild haben möchtest, male auch diese an – mit weißer Farbe.• Denke auch an den Einsatz von Komplementärkontrasten, damit dein Bild richtig schön leuchtet.• Möchtest du die Umrisslinien noch einmal nachziehen? Tipp: Du kannst die Wirkung deines Bildes noch steigern, indem du es auf ein dunkles Papier aufklebst, das etwas größer ist, oder indem du einen dunklen Rahmen malst. Folgt uns auf Facebook oder Instagram! Dort werden wir auch alle neue Aktion verlinken. Wenn ihr uns eure Kunstwerke zeigen wollt, verwendet den Hashtag #MPZtierisch. MPZ-Online-VeranstaltungMusPad: Die Welt der Tiere (GS, ab Jgst. 2)MusPad: Vom Haustier bis zum Fabelwesen – Tierdarstellungen in der Kunst (MS, RS, GYM bis Jgst. 11) Passende MPZ-FührungGrüne Nasen, gelbe Kühe und der Blaue Reiter (Horte, Inklusionsklassen, MS, RS, BS, FöS, GS, GYM)Von gelben Kühen und blauen Pferden (Kindergarten, ab 4 Jahren)Bunte Tierwelten – von Fleckvieh, blauen Pferden und schrillen Vögeln (Fortbildung für Pädagogisches Fachpersonal)Bunte Welten, grüne Nasen und der Blaue Reiter (Fortbildung für Lehrkräfte aller Schularten) Informationen zum Museum In der Städtischen Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München ist die weltweit größte Sammlung zur Kunst des Blauen Reiter zu finden. Einen wunderbaren Einblick in diese Sammlung bietet die Website Der Blauer Reiter des Lenbachhauses sowie die Online-Sammlung des Museums. Abbildungsnachweis Titelbild: Franz Marc, Kühe, rot, grün, gelb, 1911, Öl auf Leinwand (Ausschnitt), Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, CC BY-SA 4.0. Bearbeitung: Museumspädagogisches Zentrum
In unserer neuen Reihe #MPZbayernweit reist du digital zu vielen spannenden Orten in Bayern. Mitten im Herzen von Fürth kannst du wortwörtlich in den Untergrund „abtauchen“. In Oberfranken begegnet dir ein Enterich, der gerne wie Goethe und Schiller spricht. Auf Entdeckungsreise in die Welt der Fabeln und Märchen geht es in Murnau. Dass auch Möbelstücke Geschichten erzählen können, verrät uns ein Blick nach Abensberg. Und in Augsburg wimmelt es von Farben und Mustern . Überall gibt es Schätze zu entdecken! Folgt uns auf Facebook oder Instagram! Dort werden wir auch alle neuen Aktionen verlinken. Wenn ihr uns eure Kunstwerke zeigen wollt, verwendet den Hashtag #MPZbayernweit. Abbildungsnachweis Titelbild: © Museumspädagogisches Zentrum
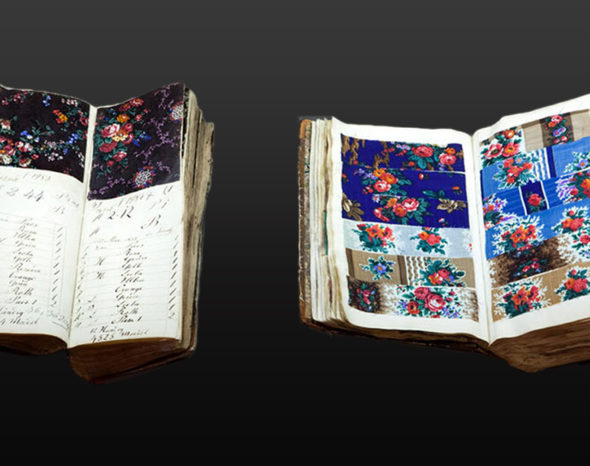
Was wäre unsere Kleidung ohne farbige Drucke und Muster? Ganz schön langweilig, oder? Die bunte Welt der Muster! Baumwollpiquékleid mit Petticoat aus den 1960er Jahren. © Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim) Im Staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg – kurz tim - wimmelt es nur so von bunten Mustern und bunt bedruckten Stoffen!Auf diesem Kleid aus den 1960er Jahren blüht beispielsweise eine ganze Blumenwiese aus roten und schwarzen Blütenranken.Das Kleid ist schon über 60 Jahre alt und stammt aus der sogenannten „Wirtschaftswunderzeit“. Das ist die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Den Menschen in Deutschland ging es wieder besser, sie hatten nach den harten Kriegsjahren ein großes Nachholbedürfnis. – Auch in der Mode.Die Stoffe aus dieser Zeit waren kunterbunt und voller üppiger Muster. Der Pariser Designer Christian Dior erfand in den 1950er Jahren den sogenannten "New Look", was übersetzt „Neues Aussehen“ bedeutet. Die Damen trugen glockenförmige, wadenlange Röcke aus fließenden Stoffen und mit einer “Wespentaille". Diese ist wirklich nach der Wespe benannt, die eine extrem schmale Taille hat.Unter den Röcken trugen die Damen Petticoats aus Tüll. Diese bunten Unterröcke ließen die Kleider noch glockenförmiger aussehen. Muster Muster Muster! Blätter, Blumen, Kringel, Kreise, Quadrate, Vierecke und Rauten, sogar ganze Obstkörbe oder wilde Tiere gibt es auf den bunten Textilien im tim zu entdecken.Besonders viele Muster findest du in unserer „Schatzkammer“. Dort liegen über 500 Musterbücher. Darin stehen keine Geschichten zum Vorlesen. Die Bücher sind über und über mit kleinen Musterstücken aus einer ehemaligen Augsburger Stoffdruckerei beklebt.Über 1,5 Millionen verschiedene Muster aus 250 Jahren gibt es hier zu bestaunen. Musterbuch aus einer ehemaligen Augsburger Stoffdruckerei. © Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim) Wenn du mal hier im tim bist, dann kannst du selbst zum Designer werden und diese Muster zum Leben erwecken. Mit Hilfe eines Computers überträgts du die Muster auf unsere Grazien – das sind über vier Meter hohe Damenfiguren, die dann jeweils das Muster anziehen, das du an einem Touchscreen ausgewählt hast. Digitale Muster auf über vier Meter hohen Grazien (Damenfiguren) in der Dauerausstellung des tim. © Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim) Vielleicht hast du jetzt Lust bekommen, auch ein Muster zu entwerfen? Hier kannst du dich austoben! Kreative Anregungen und Hintergrundinformationen Willst du wissen, wie Muster auf Stoffe kommen? Oder möchtest du vielleicht sogar selbst ein paar Muster entwerfen? Dann hol dir das neue Mitmach-Heft „Mit Fussel durch das tim“! Es hält für dich auch viele weitere Rätsel und Geschichten rund um Textilien, Kleidung und Mode bereit.Auch in unserer aktuellen Sonderausstellung mit dem Titel „Amish Quilts meet Modern Art“ haben sich viele Muster versteckt. Wenn du ganz genau hinschaust, dann kannst du in den farbenfrohen Quilts eine Menge solcher Strukturen entdecken! Quilts sind bunte Bettdecken, die in der Ausstellung nicht auf dem Bett liegen, sondern als Kunstwerke an der Wand hängen. In einem spannenden Entdecker-Video kannst du dich auf eine faszinierende Reise durch die Sonderausstellung im tim begeben. HIER erfährst du unter anderem, wer die Amish People sind und was gemusterte Bettdecken mit zeitgenössischer Kunst zu tun haben. Informationen zum MuseumWeitere Informationen zum tim und seinen Vermittlungsangeboten findest du HIER. Für diejenigen, die das tim gerne digital erkunden möchten, steht ein Audioguide mit spannenden Textilgeschichten bereit, die Augsburger Schülerinnen und Schüler entwickelt haben. Abbildungsnachweis Titelbild: Zwei Stoffmusterbücher aus einer ehemaligen Augsburger Stoffdruckerei. © Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim)